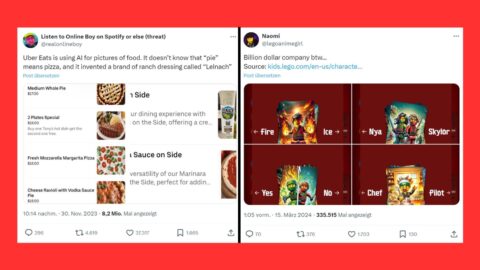Vor wenigen Tagen teilte das Erzbistum Köln mit, dass sein „Mediendirektor“ Christoph Hardt „um die Auflösung seines Vertrags gebeten“ habe und seine Tätigkeit Ende Februar beenden werde. Wenn ich mich nicht verzählt habe – nageln Sie mich nicht fest –, war das dann der vierte oder fünfte Pressesprecher respektive Kommunikationschef des Bistums innerhalb weniger Jahre.
Hardt hatte – wie das Bistum in seiner Pressemitteilung ausdrücklich betont – „die Aufgabe erst im Juli 2021“ von Hermann-Josef Johanns übernommen, der die Hauptabteilung Medien und Kommunikation seit Dezember 2020 kommissarisch geführt hatte. Dessen Vorgänger war Markus Günther, der auf Christoph Heckeley folgte. Mag sein, dass ich an dieser Stelle den einen oder anderen Namen vergessen habe.
Die genaue Zahl ist auch nicht entscheidend. In jedem Falle machen die vielen Personalwechsel in der Kommunikation des Kölner Bistums einmal mehr deutlich, wo ein Problem in der derzeitigen Krise der Kirche in Deutschland liegt: in der Kommunikation. Und das nicht erst seit Kurzem.
Kirche erneuert sich durch ihre Sprache
Die Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler schreiben in ihrem Buch „Phrase unser“, das vor zwei Jahren herauskam: „Die Kirche ist gegründet auf dem Wort und erneuert sich auch immer wieder durch das Wort.“ Und das mit der Erneuerung scheint ein ganz dickes Brett zu sein, an dem sich wohl in Köln und anderswo schon viele Menschen abgearbeitet haben. Denn Bemühen um eine andere Sprache von Kirche gab es schon oft. Sowohl in der Binnen-Sprache als auch in der Kommunikation nach außen. Zwischen den beiden muss man unterscheiden, und doch gilt für beide ein Ruf nach Erneuerung und Wandel.
Es ist wie bei den Synapsen zwischen Nervenzellen: Damit Sender- und Empfänger-Zellen Botschaften austauschen können, braucht es diese Synapsen, und die müssen sich immer wieder erneuern. Das sagt uns jeder Neurologe. Lässt diese regelmäßige Auffrischung nach oder passiert sie gar nicht mehr, kann das zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson führen. Die Kommunikation zwischen den Neuronen funktioniert dann nicht mehr richtig – es kommt zu Störungen. Informationen können nicht mehr verarbeitet und weitergeleitet werden. In der Kirche ist das (im übertragenen Sinne) ganz genauso.
Differenzieren zwischen interner und externer Kommunikation
Doch sei hier differenziert: Da ist zum einen die Sprache in der Kirche, in der Liturgie, gegenüber den Gläubigen und den feiernden Gemeinden. Da hat sich schon sehr viel getan. Vor sechzig Jahren war zum Beispiel Latein in einem Gottesdienst noch völlig normal. Aber manchmal passiert es, da steht einem doch noch ein in mittelalterlicher Sprache von Fegefeuer und ewiger Verdammnis hängengebliebener Zelebrant gegenüber. Wir Aktiven tun viel dafür, um Synapsen zwischen Kirche und Gemeinde zu erneuern. Immer wieder mit einem Blick fürs Aktuelle. Ein Fernseh-Pfarrer hat es mal so ausgedrückt: „Bloß kein frommes Gelaber.“
Öffentlich sehr viel prominenter und präsenter ist die quasi politische Sprache der Kirche, die Äußerungen in Interviews, öffentlichen Verlautbarungen oder Talkrunden im Fernsehen. Hier passiert es immer wieder, dass Akteure wenig überzeugend, oberflächlich, aalglatt und an der Erwartungshaltung einer durchaus zuhörenden Öffentlichkeit vorbei kommunizieren. Empfänger-orientiert geht anders.
Der Kollege Lothar Schröder von der „Rheinischen Post“ schreibt: „Es gibt viele Anzeichen für Krisen. Eins davon ist unzureichende Kommunikation.“ Die hat man dem Bistum Köln und dem noch amtierenden Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki immer wieder vorgeworfen. Der permanent wiederholte Vorwurf macht natürlich noch lange keine Wahrheit, und ganz fair und objektiv war das fast schon Shitstormhafte gegen Woelki und gegen die katholische Kirche im vergangenen Jahr sicherlich nicht. Leider stimmt aber auch, dass seine Art der Kommunikation Erwartungen enttäuscht und Vertrauen zerstört hat. Und damit meine ich nicht das umstrittene Zurückziehen von Missbrauchsgutachten. Ich kenne Fachjuristen, die diese Entscheidung als rechtlich und fachlich naheliegend und völlig in Ordnung bewerten. Aber es ist wie so oft eine Frage, wie man es vermittelt. Der Ton macht die Musik.
Und die unglückliche, weil am Ende wohl wenig Erfolg bringende, Beauftragung offenbar nicht besonders guter Kommunikationsberater für ein in meiner Wahrnehmung desaströs hohes Honorar hat dem Ganzen eine unrühmliche Krone aufgesetzt. Und das sage ich als überzeugter und praktizierender Katholik. Ich habe mich dann schon gefragt: Hatten diese Berater die Lage dermaßen verkannt? Hatten sie keine Ideen für wichtige Botschaften und überzeugende Auftritte? Haben sie Woelkis Krisensituation schamlos ausgenutzt, oder war der Kardinal wirklich so beratungsresistent?
Ein semantisches Rauschen – aber keine Botschaft
Gerade bei Kirchenleuten haben Wahrnehmung, Vertrauens- und Imagebildung extrem viel mit der Sprache zu tun. Feddersen und Gessler mahnen in ihrem leider etwas einseitig am Protestantismus ausgerichteten Buch: „Eine Kirche, die mit ihrer Sprache nur noch die Ihrigen, die Gläubigen, erreicht und nur noch von ihnen verstanden wird, verliert sich in einer selbst gewählten Wagenburg, in einer splendid isolation.“
Der Satz erinnert mich an einen Auftritt Woelkis bei einem Jubiläums-Gottesdienst des Dominikaner-Ordens in Köln im vergangenen Jahr. Zuvor waren heftige Kritik wegen der Arbeit mit den Missbrauchsgutachten und erste Rücktrittsforderungen an den Kardinal laut geworden. Ich nahm an, er werde darauf in seiner Predigt eingehen. Das tat er zwar irgendwie so ein bisschen – ich habe aber irgendwann nicht mehr richtig hingehört. Denn es blieb ein – ich kann es nicht anders sagen – Gesäusel. Eine kraftlose Ansprache, zehn Minuten lang in immer gleichem Duktus und mit einer Stimm-Melodie ohne jede Nuance, ohne Betonungen (manche nennen das auch „Singsang“).
Für uns Redenschreiber ist das ein Graus. Da kann man sich vorher noch so viele Stunden hingesetzt, recherchiert und formuliert und das Hirn zermartert haben auf der Suche nach den richtigen Worten. Wenn die dann so dargebracht werden, geht die Botschaft auf dem Weg vom Sender zum Empfänger schnell verloren. Es bleibt dann nur ein „semantisches Rauschen“, wie der Theologe Friedrich Niebergall das wohl mal genannt hat.
Also: Liebe Kirche, bitte ändert Eure Sprache. Dieses Jahr gilt’s.
Im folgenden Teil dieser Kolumne geht unser Autor der Frage nach, warum auch journalistische Medien ihre Sprache überdenken sollten.