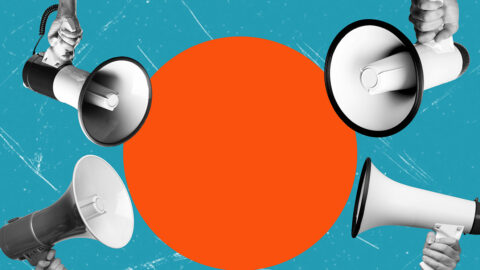Vor sieben Jahren spazierte Hans Georg Näder nach einem Disput mit einem Barkeeper im Soho House durch das nächtliche Berlin. Der Inhaber des Medizintechnikunternehmens Ottobock wollte einen Gin Tonic trinken, ihn jedoch nicht – wie in dem Privatclub Usus – auf Englisch bestellen. Auf seinem Streifzug durch den Prenzlauer Berg entdeckte der heute 55-Jährige das brachliegende Areal der ehemaligen Bötzow-Brauerei. Ein 24.000 Quadratmeter großes Gelände, zwischenzeitlich als Lager, Galerie und Club genutzt –, das in ihm die Vision wachrief, dort die digitale Zukunft seines Familienunternehmens Ottobock gestalten zu können. Innerhalb von acht Wochen wickelte Näder den Kauf ab.
Michael Hasenpusch, Leiter des Open Innovation Space, erzählt diese Anekdote und schmunzelt, zeigt auf das riesige Modell, mit dem der britische Stararchitekt David Chipperfield den Masterplan für Bötzow Berlin visualisiert hat. „Herr Näder hat ständig neue Ideen“, sagt Hasenpusch. „Er fertigt immer wieder eigene Skizzen an für sein Ökosystem aus kreativem Kommunikationsplatz, wissenschaftlicher Einrichtung und Start-up-Herberge. Was wir Ihnen hier zeigen, ist vorläufig.“ Der promovierte Ingenieur leitet den Open Innovation Space seit einem Jahr. Rund 200 Millionen Euro kostet das gesamte Projekt. Die über 130 Jahre alten Brauerei-Gebäude aus rotem Klinker sollen künftig Räumlichkeiten für Start-ups, Co-Working-Spaces und strategische Unternehmensbereiche bieten. 8.600 Quadratmeter sind dafür eingeplant.
Warum das alles? Die Produktentwicklung des inhabergeführten Mittelständlers, durch Näders Hand längst zum Hightech-Unternehmen avanciert, hat durch das regulatorische Umfeld und hohe Dokumentationlast an Tempo verloren. Darauf wurde bereits reagiert, indem der Produktentstehungsprozess verschlankt wurde. Doch soll die kostbare Kreativität der Mitarbeiter am Leben erhalten, gar wiederbelebt werden. Das soll nun in Berlin geschehen, dem Ort, an dem später Ottobock-Mitarbeiter experimentieren können, abseits jeglicher Prozess- und Dokumentationspflichten. Im Ottobock-Interimsgebäude, dem „Zelt“, wie Michael Hasenpusch es nennt, können bereits jetzt Tüftler der Kooperationspartner Fab Lab Berlin von Makea Industries die Köpfe zusammenstecken.
Etwas abseits befindet sich ein kleiner Raum, das Human Mobility Service Center, zugestellt mit Rollstühlen. „Das ist ein Pilot, den wir ganz leise testen“, sagt Michael Hasenpusch. „Wir wollen niemandem im Headquarter in Duderstadt auf die Füße treten.“ Hier werden Rollstühle getunt. „Und was soll ich sagen? Es fliegt“, sagt der Ingenieur und lächelt zaghaft. Neid in den eigenen Reihen ist etwas, womit jedes Unternehmen, will es innovativ sein, souverän umgehen muss. Stellen sich die Fragen: Wie lassen sich alte und neue Welt, traditionsreiches Duderstadt und schwungvolles Berlin, miteinander verbinden? Wie finden Ideen zurück ins Unternehmen? Wie kommuniziert man, dass Kreativität fortan woanders stattfindet?
Die Antworten darauf geben Michael Hasenpusch und Mark Schneider, Leiter Unternehmenskommunikation, über den Dächern vom Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg; in einem rostorangenen Baucontainer, der wie ein Würfel auf den anderen gestapelt mitten auf dem Bötzow-Areal steht. Wir wollen über Kreativität sprechen, und die entfaltet sich bekanntlich am besten an ungewöhnlichen Orten.
Michael Hasenpusch (links) und Mark Schneider (rechts) im Gespräch mit Redakteurin Jeanne Wellnitz (c) Julia Nimke
Herr Hasenpusch, warum hat Ottobock die Kreativität ausgelagert?
Michael Hasenpusch: Als Medizintechnikunternehmen muss bei uns einfach alles vollständig geplant und dokumentiert werden. Wie viel wird die Entwicklung kosten? Wie lange wird sie dauern? Wie groß ist das Marktpotenzial? Eine Priorisierung wird abgeleitet, Projektaktivitäten werden entsprechend eingeordnet. Das tötet Kreativität und macht die Produktentwicklung langsam.
800 Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen in der Abteilung Forschung und Entwicklung.
Diese Größe macht es einfach notwendig, dass wir in unserem Headquarter Duderstadt und den etablierten Entwicklungsstandorten entlang definierter Prozesse arbeiten. Unsere Mitarbeiterbefragungen ergaben: Die Zufriedenheit ist überdurchschnittlich, wenn Mitarbeiter weniger als zwei Jahre im Unternehmen sind. Das bedeutet: Zwei Jahre reichen, um sie so einzunorden, dass sie die Prozesse einhalten und so kaum noch kreativ sein können.
Ideen haben kaum Möglichkeiten, sich zu entwickeln?
Ja, wenn das vermutete Potenzial zu einer Idee nicht ausgewiesen werden kann, wird sie nicht unterstützt. Also müssen wir ihr an anderer Stelle eine Chance geben, den nächsten Reifegrad zu erreichen. Deshalb ist dieser Standort so wichtig. Er muss seinen spielerischen Charakter behalten. Wir entwickeln in Berlin keine Medizinprodukte, das ist der Linie vorbehalten. Hier können Ideen getestet und in Prototypen gegossen werden.
Haben Sie zuvor auch Ideenräume vor Ort ausprobiert?
Es gab Überlegungen, demonstrativ einen Glaskasten aufzustellen, in den die Leute mit strahlenden Augen reinkommen, bis sie eine Lösung haben, nicht früher. (lacht) Wir haben es auch mit Ideenoasen probiert, in denen sich die Leute jenseits der Arbeit austauschen können. Doch solche Oasen plätschern dann im Alltag eher vor sich hin. Zusätzlich ahnten wir, dass es mehr Wettbewerb und Neid generieren würde, wenn wir Ideenräume vor Ort schaffen. Somit bietet der Open Innovation Space das richtige Ambiente für Kreativität mit ausreichend Abstand zu den strukturiert agierenden Standorten.
Mit dem Space suggeriert man den Mitarbeitern im Headquarter doch ungewollt: Ihr seid nicht kreativ, wir schon. Wie sorgt man für deren Zufriedenheit in Duderstadt?
Wir forschen an mehreren Standorten weltweit und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Das wissen die Mitarbeiter. Wir haben auch an verschiedenen Standorten fünf bis zehn Prozent der Arbeitszeit freigestellt, damit sie wieder kreativer sein können. Das gelang nicht, weil die Projektplanung und die Tätigkeiten an mehreren Projekten die Freiräume wieder auffressen. Deshalb laden wir sie nun ein, hier im Future Lab künftig temporär zu arbeiten. Dennoch bleiben Duderstadt, Wien und Salt Lake City wichtige Standorte, auch in Entwicklungsfragen.
Michael Hasenpusch erläutert anhand des Modells vom britischen Stararchitekten David Chipperfield den Masterplan für Bötzow Berlin (c) Julia Nimke
Und wie finden die Mitarbeiter in Duderstadt den Open Innovation Space?
Sie fragten sich anfangs, was wir hier eigentlich genau machen. Auch der offene Umgang mit der Maker-Community ist für sie ungewöhnlich. Sie haben es anders gelernt: Ideen offen kommunizieren!? Sie denken eher: Wenn ich eine Idee habe, halte ich sie geheim. Dann wird eine Erfindungsmeldung platziert, daraus geht idealerweise ein Patentschutz hervor. Wenn das erfolgt und gesichert ist, darf ich offiziell darüber reden.
Mark Schneider: Dieses Spannungsfeld herrscht zwischen Start-up und Unternehmen oder eben im Unternehmen selbst. Und da habe ich es doch lieber im Unternehmen. Die Frage ist, wie kann ich mich wandeln? Diese Spannung lässt sich gar nicht auflösen und es ist ja auch gewollt, dass sich die Etablierten herausgefordert fühlen.
Wie bringen Sie die beiden Welten zusammen?
Hasenpusch: Wir versuchen permanent vernetzt zu sein. Es wurde funktionsübergreifend eine 3D-Druck-Task-Force gebildet: Dort sitzen Mitarbeiter aus der Business Unit Medical Care, der Entwicklungswerkstatt, aus Operations und dem Global Technology Center sowie Produktmanager für individuelle Produkte – diese Mannschaft spricht regelmäßig miteinander.
Warum wurden Sie als Leiter des Open Innovation Space ausgewählt?
Hans Georg Näder war wichtig, dass der Leiter in Berlin vernetzt ist und das Unternehmen kennt. Denn das, was wir hier machen, ist immer noch Teil von Ottobock und keine freifliegende Parallelveranstaltung. Ich bin seit mehr als 18 Jahren im Unternehmen, stamme ursprünglich aus Berlin. Ich war zwölf Jahre lang Chief Technical Officer, habe dann vier Jahre lang eine neu gegründete Business Unit Medical Care geführt. Die habe ich 2016 übergeben, weil Herr Näder mir anbot, den Open Innovation Space zu leiten.
Wie wurde die Gründung vor zwei Jahren intern kommuniziert?
Zu Bötzow hat es nahezu von Beginn an ein Bulletin gegeben; eine Zeitung, die bislang fünf Mal erschien. Über das Intranet wurde natürlich viel gelöst. Außerdem werden alle Aktivitäten auf einem Sharepoint abgebildet: Dort steht, welche Kontakte gepflegt werden, welche Projekte laufen. Darauf lässt sich funktionsübergreifend zugreifen. Die Mitarbeiter wurden auch zur Besichtigung eingeladen. Bei der Eröffnung 2015 war der Platz hier voll, die Hälfte davon waren Mitarbeiter.
Herr Schneider, Sie haben vor zwei Monaten als Leiter Unternehmenskommunikation bei Ottobock gestartet, sitzen hier in Berlin, Ihr Team in Duderstadt. Warum?
Schneider: Ich bin wie Herr Hasenpusch in Berlin und Duderstadt, um die beiden Welten zusammenzubringen. Mit meinem Team funktioniert das sehr gut, die Kollegen kommen auch oft nach Berlin. Wir sind ja auch überschaubare sieben Leute.
Wer war Ihr Vorgänger?
Bislang verantwortete Christin Gunkel als Marketinggeschäftsführerin zusätzlich die Kommunikation. Meine Position gab es vorher in dieser Konstellation noch nicht. Auch die Berichtslinie an Herrn Näder ist neu. Als Teil des Marketings wäre die Gefahr groß, dass wir in die Rolle des reinen Dienstleisters rutschen. Künftig geht es darum, die gewaltigen Veränderungen des schnellen Wachstums und den geplanten Zugang zum Kapitalmarkt zu kommunizieren. Wir machen gerade sehr viel auf einmal. Wir müssen deshalb immer wieder die Strategie erklären. Momentan ist interne Kommunikation daher fast noch wichtiger als externe Kommunikation.
Sie waren vor Stellenantritt Journalist. Was sind für Sie persönlich die größten Herausforderungen dieses Rollenwechsels?
Als Journalist dachte ich oft: Mensch, warum dauert es denn so lange, bis mich der Pressesprecher zurückruft? Nun erlebe ich selbst, wie verzwickt es sein kann, alles abzustimmen. Ansonsten war dieser Wechsel für mich gar nicht so schwer, weil ich schon einmal Sprecher im Wissenschaftsministerium in Hannover war. Momentan planen wir verschiedene Formate wie Tech Days, um Themen wie die intuitive Prothesensteuerung für Journalisten greifbar zu machen. Früher zeigten wir nur, was marktreif ist. Wir wollen nun stärker klarmachen, woran wir aktuell arbeiten.
Eine Armprothese bestehend aus einem felxiblen Schaft und einer Michelangelo-Hand, die Anwendern zahlreiche Funktionen der natürlichen Hand zurückgibt (c) Julia Nimke
PR sitzt also bei der Produktentwicklung mit am Tisch.
Das ist Teil des Transformationsprozesses, in dem wir stecken. Bislang sind wir manchmal zu spät eingebunden worden. Da ich Teil des Managementteams bin und dadurch an den relevanten Sitzungen teilnehme, ist es mir möglich, Themen unmittelbar zu identifizieren und mit meinem Team geeignete Strategien zu entwickeln.
Wenn ein Mitarbeiter aus Duderstadt hier in Berlin eine Idee ausprobieren möchte, wie wird das organisiert?
Hasenpusch: Bislang haben wir noch kein festgelegtes Modell für längerfristige Aufenthalte unserer Mitarbeiter in Berlin. Wenn sie gerade eine Familie gegründet haben, kann die Hürde groß sein, die Stadt zu wechseln. Ganz so einfach, wie wir am Anfang dachten, ist es nicht. Wir sehen jedoch Interesse und jede Menge Tagesbesucher.
Schneider: Herr Näder bekommt Bewerbungen, in denen auf Berlin als Einsatzort bestanden wird. Talente, die wir nicht nach Südniedersachsen kriegen, können wir so rekrutieren. Selbst wenn das mitunter bedeutet, dass wir für junge Talente eher wie ein Bienenstock fungieren. Heutzutage hält man sie häufig für zwei bis drei Jahre, dann ziehen sie weiter. Und das hat auch Vorteile: Sie sollen nicht nach einigen Jahren als Teil des Ganzen automatisch zum Establishment werden. Jubiläen von 20 oder 30 Jahren wird es künftig kaum noch geben. Die große Kunst ist, dass immer wieder Neue kommen.
Hasenpusch: Hasenpusch ist ein Auslaufmodell. (lacht)
Schneider: (lacht) Du bist das wichtigste Bindeglied dieser beiden Welten.
Werden PR und HR auch im für 2018 geplanten Berliner Future Lab sitzen?
Wenn wir jemand Neues im PR-Bereich für die Sozialen Medien einstellen, würden wir das wohl hier aufbauen. Was HR betrifft, gibt es bislang keine Planungen, Personaler in Berlin anzusiedeln.
Wie werden die Kreativen dann von HR betreut?
Von den 200 Kreativen gibt es ja nur einen Kernteil an Ottobock-Mitarbeitern, die werden von unseren Global HR Business Partner Teams betreut. Der Rest sind, wie Herr Näder es gerne sagt, Kolibris, die von Blume zu Blume fliegen. Die müssen nicht alle von HR betreut werden.
Hans Georg Näder sagt im Spiegel-Classics-Porträt, viel Bewegung sei gut für eine kreative Firma. HR hat jedoch naturgemäß den Anspruch, Talente langfristig an das Unternehmen zu binden. Wie wird dieses Spannungsfeld aufgearbeitet?
Einige sind eben nach wenigen Jahren wieder weg. HR ist hingegen ehrgeizig, auch diese Leute durch ein systematisches Talent-Management- und High-Potential-Programm langfristig ans Unternehmen zu binden. Das ist nicht zwingend ein Widerspruch, sondern das sind zwei Sichtweisen: die des Unternehmers, für den die wichtigen Impulse der Kreativen zählen, und die von den HRlern, die Mitarbeiter durch Entwicklungschancen binden möchten. So könnte Ottobock schließlich wieder attraktiv für neue Talente sein, die hier ihre Wachstumsmöglichkeiten sehen. Es wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Unser Chief Strategy & HR Officer, Sönke Rössing, gestaltet das mit seinem Team mit.
Welchen neuen Weg geht eine Idee nun bei Ottobock?
Hasenpusch: Es gab eine Reihe von Initiativen. Beispielsweise einen Wettbewerb mit 1.800 internationalen Einreichungen. Wir haben mit Studenten der Kunsthochschule Weißensee über künstliche Haut und Knochen philosophiert und geforscht. Zwei der Teilprojekte waren hochinteressant für Ottobock: die Gestensteuerung für Armprothesenträger ohne Zusatzeingabehilfen und ein Therapiekatalog für Beinamputierte, in dem über eine App Physiotherapeut und Patient vernetzt werden. Dafür haben wir das Produktmanagement begeistern können. Den Preis haben wir übrigens gewonnen. Ein weiterer Erfolg ist unsere Beteiligung an unterschiedlichen Förderprojekten.
Schneider: Was ich in den letzten Wochen gelernt habe, ist, dass sich das Geschäftsmodell der Prothetik durch die Digitalisierung verändert: Die Prothese und den Stumpf zusammenzubringen, das ist die große, bislang handgefertigte Kunst. Eine naheliegende Modernisierung des bisherigen Prozesses ist es, den Stumpf zu scannen, danach bearbeitet ihn der Orthopädietechniker. Das würde enorm Kosten sparen. Der Open Innovation Space ist die ideale Bühne, um das zu testen. Momentan scheitert es noch an der Festigkeit des Materials. Aber es ist eine naheliegende Vision.
Hasenpusch: Wir hetzen einer Industrie 4.0 nicht hinterher, weil wir uns seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Die Fertigungsprozesse basieren jedoch noch nicht auf einer durchgängigen digitalen Prozesskette. Diese zu komplettieren, das treibt uns um.
*******
Was ist ein Digital Lab?
Berlin gilt in Deutschland als Hochburg von Digital Labs. Sie sind für viele Unternehmen Grundlage der Digitalisierungsstrategie. Laut Crisp Research Report (2016) haben bislang knapp zwei Drittel der Dax-30-Konzerne eigene Labs errichtet oder befinden sich momentan im Aufbau. Das IT-Beratungsunternehmen prognostiziert, dass sich bis 2020 die Zahl der Unternehmen mit eigenem Lab von 60 auf 300 erhöhen wird. Es gibt verschiedene Ausprägungen von Ideenlaboren:
Lab
Das sind unternehmenseigene kreative Räume, in denen die eigenen Mitarbeiter in interdisziplinären Teams mit neuen Technologien experimentieren können.
Open Space
Ein Open Space ist eine offene Plattform für den kreativen Austausch zwischen Köpfen aus vielen Disziplinen und Ländern.
Accelerator
Ein Accelerator bietet Programme an, für die sich Gründerteams und Seed-Stage-Start-ups bewerben können. Er treibt innerhalb eines beschränkten Zeitraums als Beschleuniger den Wachstumsprozess durch Coaching von Spezialisten voran.
Inkubator
Inkubatoren beteiligen sich an frühen Entwicklungsphasen von Start-ups und Gründerteams. Diese können jederzeit teilnehmen und werden durch Know-how, Netzwerk, Büros unterstützt. Es geht weniger um schnelles Wachstum.
Hub
Ein Hub ist eine Schnittstelle für Nutzer, in der verschiedene Elemente zusammengeführt werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KREATIVITÄT. Das Heft können Sie hier bestellen.