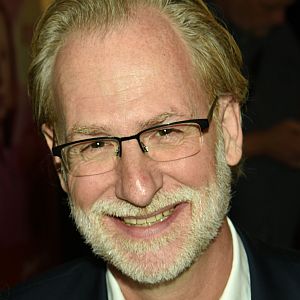Es gibt sie immer wieder: die Lichtgestalten der großen Medieninterviews, die Rampensaue von Konzernen, die das Unternehmen in allen Medien – vor allem jenen, die vom Bewegtbild zehren – ziemlich weit nach vorne bringen. Doch dahinter verbirgt sich nur in seltenen Fällen ein Naturtalent, sondern meist jahrelange harte Arbeit. Was mühsam klingt, hat auch etwas Gutes: Hart arbeiten kann jeder, wenn er denn will, die richtigen Prioritäten setzt und Ressourcen nutzt.
Kopf ausschalten
Die sogenannte „Scheu vor der Kamera“ liegt nicht wirklich daran, dass jemand zu bescheiden ist, öffentliche Präsenz zu zeigen. Eher ist die Ursache eine überdurchschnittliche Selbstreflexion: Wer sieht jetzt alles zu? Wie wirke ich? Mache ich alles richtig? Bin ich kompetent? Wie ist der Bildausschnitt? Wie schneiden die das hinterher zusammen? Fragen, um deren Antworten man sich in der Vorbereitung sehr wohl kümmern sollte und nicht erst, wenn man einen Medienauftritt hat. Hier sollte man sich über seine eigenen Kompetenzen bewusst sein und wissen, welche Aussagen im Augenblick wichtig sind.
Manchmal hilft die Methode mit dem Holzhammer. Ein Vorstandsmitglied eines TecDax-Unternehmens briefte mich beispielsweise mit nur einem Satz: „Ich komme zu Ihnen und gehe nicht eher weg, bis meine Kameraangst weg ist.“ Die Angst war nach zehn Stunden weg. Wie das ging? Auf einer belebten Kölner Einkaufsstraße steckte ich ihm ein Funkmikrofon als Anstecker an. Über eine Strecke von 100 Metern musste er immer wieder auf die Kamera zugehen und einen vorab inhaltlich definierten Text vor der Kamera frei formulieren und dabei seine Umgebung einbeziehen.
Ein Thema seines Textes war die Veränderung des Preisniveaus seines Unternehmens. Ging neben ihm eine Mutter mit Kinderwagen, textete er beispielsweise etwas über die „Zukunft künftiger Generationen“. Als er eine Frau mit Rollator begleitete, textete er: „Damit auch ältere Menschen sich einen würdigen Lebensstandard leisten können.“ Die Kamera war plötzlich sein geringstes Problem. In einer anderen Situation war er ein Reporter vor laufender Kamera und führte mit einem Mikrofon in der Hand Straßenumfragen und Interviews durch. Ebenfalls zu den Themen seines Unternehmens. Ergebnis des Trainings war: Der „kamerascheue“ Vorstand gab in den nächsten Jahren eine souveräne Videobotschaft nach der anderen und hatte sichtlich Freude daran.
Die Kamera als Geliebte
Als ich selbst einmal Lampenfieber vor der Kamera hatte, gab mir damals der Regisseur folgenden Tipp: „Stell dir vor, die Kamera ist deine Geliebte. Die musst du einfach gern haben.“ Jetzt sagt uns die Lebenserfahrung, dass auch Geliebte für reichlich Stress sorgen können. In Zeiten von #MeToo ist diese Formulierung sicher nicht mehr zeitgemäß, aber in den Neunzigerjahren war das noch so. Die Kamera als „beste Freundin“ oder „bester Kumpel“ tut es heutzutage auch.
Technisch hilft der Blick auf die „Nasenwurzel“ der Kamera. Wenn Sie einen Gesprächspartner nicht mögen und Sie trotz der körperlichen Nahe etwas mehr Distanz herstellen wollen, schauen Sie ihm auf die Nasenwurzel. Das sieht für alle so aus, als hielten Sie den Blickkontakt, können jedoch für sich selbst in die Ferne schauen – gewissermaßen durch Ihren Gesprächspartner durch. Die TV-Kamera hat auch eine Nasenwurzel: den Zwischenraum zwischen Kameraobjektiv und dem Kopflicht (oder Rotlicht). Das hilft beim direkten Blick in die Kamera, bei Grußworten, Image-Videos oder auch Live-Schalten, bei denen der Moderator im Studio sitzt.
Blackout als Worst-Case-Szenario
Menschen, die kamerascheu sind, tragen in der Regel ein höheres Risiko, einen Blackout zu bekommen. Für sogenannte Standard-Blackouts wie „den Faden verloren“ oder „schlecht vorbereitet“ empfehlen sich Standard-Lösungen.
Eine der einfachsten ist es, das Offensichtliche zuzugeben und den Interviewer in die Pflicht zu nehmen: „Sorry. Ich habe gerade den Faden verloren. Helfen Sie mir mal bitte kurz.“ Das funktioniert bei einem leichten bis mittelschweren Thema – nicht bei einem Zugunglück mit 100 Toten. Was aber sehr wohl funktioniert: „Ich habe die exakten Zahlen gerade nicht im Kopf. Bevor wir hier aber spekulieren – denn damit ist Ihnen ja nicht geholfen –, reichen wir die Zahlen selbstverständlich nach.“ Und wenn jemand weiter insistiert: „Ich verstehe, dass Sie da jetzt eine ungefähre Zahl hören wollen von mir. Aber Ihre Zuschauer haben meiner Ansicht nach das Recht auf konkrete Zahlen. Die liefern wir Ihnen gerne nach.“
Wie aber reagieren bei einem totalen Stromausfall im Gehirn? Hier hilft es, sich rasch über zwei Fragen klarzuwerden:
1) Will ich mich jetzt weiter mit dem Blackout beschäftigen? Ist das zielführend und habe ich Lust und Zeit dazu?
2) Was ist mein naheliegendster Gedanke zum aktuellen Thema?
Im Optimalfall beantworten Sie 1) mit „nein“ und nehmen bei 2) den Faden auf, reden gerne auch zwei bis vier Sätze drum herum, sortieren dabei aber schon den Kerngedanken. Kommen Sie mit 2) so nicht weiter, gehen Sie zurück zu 1). Im Ernst! Ihr Gegenüber und seine TV-Zuschauer haben ohnehin gerade bemerkt, dass Sie einen Blackout hatten. Sprechen Sie es offen an!
Das Publikum ist es gewohnt, Dingen, die es mit eigenen Augen sieht, mehr zu glauben als Dingen, von denen man ihm nur berichtet. Wenn Sie jetzt den Blackout offen ansprechen: „Oh. Da ist gerade mein Gedanke weg“, „Bitte verzeihen Sie: Ich habe gerade einen kurzen Blackout“ – dann beschreiben Sie das, was ohnehin gerade alle mitbekommen. Es bringt Akzeptanz und Glaubwürdigkeit zurück. Der Gedanke im Kopf der meisten TV-Zuschauer: „Stimmt. Hab ich auch gerade bemerkt“ und: „Der traut sich was. Der geht mit Fehlern aber souverän um“. In einer Interviewsituation bietet es sich an, den Interviewer anzusprechen: „Helfen Sie mir mal bitte kurz weiter.“
Doch passen längst nicht alle Tipps für alle Situationen. Einem Geschäftsführer einer Fluggesellschaft, der soeben den Tod zahlreicher Passagiere vor laufenden Kameras kommentieren muss, wird man eher einen Blackout verzeihen als einem Nahrungsmittel-Manager, durch dessen Profitgier Kunden reihenweise im Krankenhaus liegen.
Inhaltlich gut auf Interviews vorbereiten
Die größte Sicherheit vor der Kamera schafft man mit einer guten inhaltlichen Vorbereitung. Diese birgt jedoch die Gefahr, in Gewohnheitsfallen zu tappen. Was macht denn ein Vorstand den ganzen Tag? Er liest, er spricht, er telefoniert, er beantwortet Fragen seiner Mitarbeiter – und stellt selbst welche. Geht es dann ins Interview, so meint er, dass ihm die Situation genauso vertraut und alltäglich ist wie der Rest seines Tages. Falsch! Das Interview ist eine große Bühne, auf die – schlimmstenfalls – 83 Millionen Bundesbürger draufschauen können.
Kein Vorstand würde unvorbereitet in eine Aktionärsversammlung gehen – aber in ein Interview? Was soll schon passieren? Die Themen hat man doch schließlich alle drauf? Von wegen! Denn während des Interviews fällt ihm auf, dass die Fragen anders kommen als erwartet – und dann wird die Kamera omnipräsent: Denn erst jetzt wird ihm bewusst, dass er im öffentlichen Fokus steht.
Pressesprecher als Kommunikationstrainer
Die beste Vorbereitung für einen sicheren Auftritt vor der Kamera sind Pressesprecherinnen und Pressesprecher sowie eine gute inhaltliche Vorbereitung. Hier lernt man, Fragen weniger emotional zur Kenntnis zu nehmen, um sich dann auf die Antworten zu konzentrieren. Je sicherer man inhaltlich ist, desto geringer die Bedeutung der Kamerapräsenz.
Manager konzentrieren sich gerne auf Kennzahlen, Kennwerte und den Rat ihrer Rechtsanwälte. Und wenn die Zahlen stimmen, die Anwälte eventuell sogar schon die Richtersprüche der verschiedenen Instanzen bestätigen, dass man absolut richtig handelt – dann werden weiche Faktoren gerne ausgeklammert. Und dann erwischt einen die Frage nach der Moral, nach dem Schicksal der älteren Menschen oder der verbauten Zukunft von Auszubildenden auf dem komplett falschen Fuß! Moral? Natürlich!
Wenn die Rechtslage eindeutig ist, das moralische Empfinden aber ein anderes ist – weil zum Beispiel ältere Menschen ihren geliebten Schrebergarten aufgeben müssen, weil das Unternehmen dort einen neuen Verwaltungsbau plant –, dann darf ich bei Fragen in der Art „Mal unabhängig von der Rechtslage – wie bewerten Sie denn moralisch das Verhalten Ihrer Firma?“ oder „Stellen wir uns einmal vor, es wäre Ihre Großmutter, die mit 93 Jahren mitansehen muss, wie die Bagger den Ort einreisen, wo sie sogar ihre Goldene Hochzeit gefeiert hat“ keinen Blackout bekommen.
Hier muss eine angemessene und sachlich bezogene Antwort kommen. Zuweilen fällt dem Management auch erst bei der Schwierigkeit der Formulierung passender Antworten auf, dass man die eine oder andere Entscheidung vielleicht doch noch einmal neu überdenken sollte. Pressesprecher – Medien- und Kommunikationstrainer gleichermaßen – stehen hier in der Pflicht, vor einem Auftritt diese Fragen mit ihren CEOs oder Managern entsprechend durchzugehen. Nasty Questions, FAQ oder Q&A – whatever. Das funktioniert jedoch nur bei beiderseitigem Vertrauen – zu beiderseitigem Schutz.
Politiker keine guten Vorbilder
In Medientrainings werde ich oft gefragt, wie man es lernen könne, Fragen wie Politiker zu beantworten. Antwort: Gar nicht. Hier stelle ich erstmal zwei Gegenfragen: Fällt Ihnen auf, dass die nicht auf die Frage antworten? „Ja.“ Finden Sie es gut? „Nein.“ Warum also etwas „lernen“, was wir selbst nicht gut finden?
Um Unfug daherzureden, braucht man kein Kommunikationstraining. Hier hilft Touch, Turn, Talk. Heißt: das Thema berühren, es auf eine andere Ebene verlagern und dann mit möglichst interessanten Aspekten rasch hinüber zur eigenen Agenda kommen. Die Variante „Die Frage stellt sich so nicht. Wichtiger ist vielmehr …“ ist ausdrücklich nicht zu empfehlen. Diese Formulierungen überlassen wir Führungskräften bei internen Meetings. Da gehören sie hin, wenn man diesen Stil vertritt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KONTROVERSE. Das Heft können Sie hier bestellen.