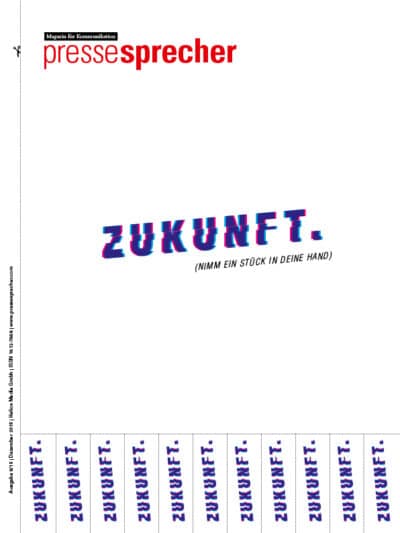Sascha Langenbach zerrt einen ins Thema. Es regnet, Langenbach hält ein Handy ans Ohr, darüber die Kapuze, es ist ein verregneter und grauer Januartag in Berlin. Satzfetzen sind zu hören, irgendwas mit „Behördenversagen“. Passt, das muss Langenbach sein, der Pressesprecher von „Deutschlands schlimmster Behörde“. Diesen Titel bekam das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales von Journalisten kürzlich verliehen, und bundesweit wird dieses „Lageso“ gerne auch mal als Flüchtlingslager bezeichnet, in dem so gar nichts klar geht.
Er kommt nicht weit, ohne auf dem Lageso-Gelände um Hilfe gebeten zu werden: Sprecher Sascha Langenbach. (c) Julia Nimke
Vor einem halben Jahr war das alles andere als abwegig, inzwischen hat sich die Lage etwas gebessert. Zelte stehen, es gibt sortierte Schlangen, genügend Security, Toiletten, Helfer. Kein Traum, aber immerhin. Langenbach hat als Sprecher für Flüchtlingsfragen der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales nun die Aufgabe, das Image aufzupolieren. Er ist oft vor Ort, jetzt nutzt er die Gelegenheit, und führt den Reporter über das Gelände ins Hauptgebäude. Man kommt nicht weit.
„Can you help me?“
Langenbach im Anzug und mit Krawatte, er muss auf all die Leute, die zu Hunderten in und vor den Aufwärmzelten warten, wie ein wichtiger Mann wirken. Immer wieder wird er angesprochen. Zum Beispiel von diesem jungen Flüchtling, der seit zwei Wochen auf die Auszahlung seines Taschengeldes wartet und jede Hilfe gebrauchen kann. Langenbach verschwindet mit ihm, zehn Minuten später kommt er zurück, und keine Minute dauert es, bis ihn der nächste Flüchtling fragt, zu welchem Amt in welchem Stadtteil er mit diesem Schein müsse, den er in der Hand hält. Auch mit ihm geht Langenbach in eines der Zelte. Als er wieder kommt, sind die beiden Flüchtlinge zu Sachbearbeitern durchgestellt und Helfern an die Hand gegeben.
Langenbach, Jahrgang 1967, ist in der Kirche engagiert, seit acht Jahren hilft er als Lesepate für Kinder mit Migrationshintergrund im Wedding. Er hilft gerne, das merkt man. Und er mag die Security-Leute, mit jedem gibt es einen Smalltalk, einen grüßt er auf Arabisch. Die meisten von ihnen haben Migrationshintergrund. Er werde hier sehr häufig angesprochen, sagt er. Von Helfern, von Flüchtlingen.
Herr Langenbach, zu den Security-Mitarbeitern haben Sie einen guten Draht. Sie scheinen den zu pflegen?
Sascha Langenbach: Ich rede gerne und viel mit ihnen. Sie sind die, die immer vor Ort sind, und wenn ich Informationen brauche, dann bekomme ich die von ihnen als erstes. Sie sind einfach unheimlich wichtig für die Arbeit hier. Die machen insgesamt einen guten Job.
Vor kurzem waren die Zeitungen voll mit den beiden Securitys, die am Lageso wegen Nazisprüchen auffielen. Auch von Gewalt gegen Flüchtlinge war mal die Rede.
Die Verantwortlichen haben bei Fehlverhalten schnell personelle Konsequenzen gezogen, das ist auch richtig so. Aber wenn Sie sehen würden, was all die anderen hier jeden Tag leisten. Wir haben Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, hier die kranken und behinderten Menschen aus den Wartereihen zu holen, damit sie sofort medizinische Betreuung bekommen. Ich kann als Sprecher damit umgehen, wenn ich medial eine Breitseite verpasst bekomme. Aber dann will ich wenigstens, dass geschrieben wird, dass die Mitarbeiter am Lageso alles Menschenmögliche tun.
Schlangestehen vor dem Berliner Röntgenmobil bei Minusgraden und schneidendem Wind. Eine Frau versucht, sich mit einer Erste-Hilfe-Decke zu wärmen. (c) Julia Nimke
Langenbach arbeitet erst seit dem 1. Dezember für das Lageso. Mit Flüchtlingen beschäftigt er sich schon länger. 2013 kam er als Sprecher auf Honorarbasis zum Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, wo er vor allem für das mediale Management der von Flüchtlingen und Asylbewerbern besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule zuständig war. Auch in seiner Zeit als Journalist war er schon in Flüchtlingsdörfern auf der ganzen Welt unterwegs. Langenbach spricht sehr viel mit Asylbewerbern, auch, wenn sie ihn nicht direkt um Hilfe bitten.
Das wirkt fast ein bisschen emotional. Besteht da nicht die Gefahr, dass man als Sprecher unprofessionell wird?
Sehen Sie, ich war mehr als ein Jahr lang jede Woche in der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg, habe mit den Leuten dort geredet, die Treffen mit den Stadträten organisiert. Ich bin ja nicht nur Sprecher, sondern auch dafür da, Informationen zu beschaffen, da arbeite ich ganz ähnlich wie ein Journalist. Und natürlich entsteht dann über diese Zeit auch eine emotionale Bindung zu den Leuten.
Aber als Sprecher müssen Sie doch auch unangenehme Sachen mitteilen, wird das dann nicht schwerer?
Ich muss natürlich professionellen Abstand wahren. Auch gegenüber den Flüchtlingen und ihren Organisationen: Bei aller Hilfsbereitschaft gibt es Leitplanken, und das sind etwa die gesetzlichen Bestimmungen, finanzielle Beschränkungen – aber auch Regeln zu einem vernünftigen Dialog. Das müssen die Menschen wissen, dafür müssen wir es ihnen aber auch erklären.
In erster Linie kommunizieren Sie nicht für die Flüchtlinge, sondern für die Journalisten und die Bürger „draußen“. Was gilt es da zu beachten?
Da gilt das gleiche. Man muss Dinge so erklären, dass sie jeder versteht. Das ist nicht selbstverständlich. Bei Behörden war es doch manchmal so, dass man nach außen zwar etwas bekannt gegeben hat, aber nicht das Warum. „Das ist halt Verwaltung“ war dann oft der Tenor. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, auch aus einer Notwendigkeit heraus. Nichts verbreitet sich heute so schnell wie Meinungen und Gerüchte, oft auf Basis von Unwissen. Wir müssen also erklären, welche Absicht wir als Behörde verfolgen, welche Zielrichtung. Immer wieder. Dass in Berlin zum Beispiel zwar 50 Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden müssen. Wir aber auch 1.000 Turnhallen haben.
Ja, die Turnhallen. Überwiegend in Innenstadtbereichen fallen diese weg, und zudem war der Platz für Vereins- und Schulsport schon vor der Flüchtlingskrise dank Geburtenanstieg viel zu gering. Langenbach weiß das, denn als Berliner Lokaljournalist berichtete er lange über die Themen Bildung und Soziales. Er ist jetzt in der Rolle eines Senatssprechers angekommen, will man meinen. Langenbach sieht das etwas anders. Man hat das Lageso inzwischen verlassen, und, nach einer Zigarette, in ein Café in der Moabiter Nachbarschaft gewechselt.
Wir sind ja jetzt schon mitten im Interview. Lassen Sie uns mal über ihre journalistische Vergangenheit sprechen. Angefangen haben Sie bei der „Bild“-Zeitung.
Begonnen hatte ich als Volontär bei der „Hamburger Morgenpost“. Danach ging ich zur „Bild-Zeitung“, und Mitte der 90er zur Bundesredaktion in Hamburg.
Sie haben sich da nicht sehr wohlgefühlt, ist zu hören?
Die Tatsache, dass ich dort nach neun Monaten aufgehört habe, muss an dieser Stelle reichen.
Haben Sie die Arbeit bei der „Bild“ bereut?
Nein, gar nicht. Ich habe ja viel gelernt, es war nach dem Volontariat eine extra Ausbildung. Man lernt dort, noch schneller, noch präziser zu arbeiten. Das fand und finde ich in Redaktionen wie die der „Bild“ schon fantastisch: Der Wille, eine Information zu bekommen, auch wenn man dafür drei Stunden länger bleiben muss als alle anderen Kollegen. Professionell gesehen sind die ganz vorne, kein Zweifel.
Langenbach beim pressesprecher-Interview in Berlin (c) Julia Nimke
Sie gingen dann nach Berlin, zum „Kurier“. Nach drei Monaten wurde Sie Lokalchef, später dann Chefreporter.
Das war toll. Jetzt kam ich in den Reichstag. Zu Hintergrundgesprächen. Auslandsreisen. Mit Otto Schily nach Afghanistan. Flüchtlingsdörfer in Sri Lanka habe ich besucht, wo Berliner als Helfer aktiv waren. In Peru war ich. Es gab sehr viel Freiraum in dieser Zeit. Das habe ich sehr genossen, war aber zu viel unterwegs. Als dann aber meine Frau schwanger war, kam es mir ganz gelegen, dass im Lokalen wieder Verstärkung gebraucht wurde und ich wieder in Berlin verankert war. Im Lokalen war ich dann für die Themenbereiche Bildung und Soziales zuständig.
War das nicht ein Rückschritt?
Nein, sehe ich nicht so. Man kann Lokaljournalismus gar nicht hoch genug schätzen, und natürlich ist das auch das Herz des „Berliner Kuriers“. Dort konnte ich dann auch kritisieren, wenn in der Stadt etwas schief lief. Aber mein Ansatz war auch schon damals, Alternativen aufzuzeigen. Leute zu Wort kommen zu lassen, die Lösungsansätze für Probleme haben.
Das Problem des „Kuriers“ wurde in dieser Zeit zunehmend die Medienkrise, der Lösungsansatz war ein Personalabbau. Mitarbeitern, die freiwillig gingen, wurde Geld geboten. Offenbar sehr viel Geld, konkret wird Langenbach da freilich nicht. Er griff zu.
Warum macht man so etwas? Sehr viele Journalisten hätten alles für so eine Stelle getan. 14 Gehälter, einen alten Tarifvertrag, alles bestens also.
Das haben mich damals viele Leute gefragt, ich war ja gerade mal Mitte 40. Aber ich hatte auch das Gefühl, ausgeschrieben zu sein. Wenn man zum dritten Mal bei der Berlinale war, mit Hannelore Elsner und Willem Dafoe Abend gegessen hast, dann war das zwar toll, aber wahrscheinlich bin ich nicht eitel genug, als dass mich das noch weiter gereizt hätte. Der Elan verstrich langsam. Und irgendwann denkst du: Wenn ich die Geschichte nicht schreibe, dann macht sie eben jemand anders. Ich wollte noch was anderes. Und darauf war ich auch neugierig.
Wie lief der Umstieg auf den Sprecherposten?
2013 habe ich beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg als Sprecher mit der Arbeit begonnen. Ich musste viel lernen, gerade im Bereich Flüchtlingspolitik. Was das Dublin-Abkommen ganz konkret bedeutet. Warum Nigeria als sicheres Herkunftsland gilt, obwohl es da unvorstellbare Bedingungen gibt. Ich glaube, die Kreuzberger Politik war damals sehr viel weiter als die Bundesebene. Die grüne Bürgermeisterin Monika Herrmann hat damals schon geahnt, dass die Flüchtlingsproblematik sich extrem verschärfen wird. Auch ich sah das damals anders. Ich habe mich dafür kürzlich bei Herrmann entschuldigt.
Sie waren dann ab 2013 vor der von Flüchtlingen und Asylbewerbern besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg dafür zuständig, Journalisten die Situation zu erklären. Sie wurden angeschrien, beschimpft. Hatten Sie sich den Seitenwechsel so vorgestellt?
Das war ganz schwierig. Alle lauerten darauf, dass ich Fehler mache, ich, als Vertreter des Staates. Mein Job war es jetzt auf einmal, draußen zu stehen und das Gesicht hinzuhalten. Das war ein ganz harter Kampf.
„Willkommen“ und „Gute Nacht“ in vielen Sprachen: handschriftlich ergänztes Schild auf dem Lageso-Gelände. (c) Julia Nimke
Hat sich in diesen Zeit ihr Bild über den Journalismus geändert?
Diese Massivität erlebte ich das erste Mal so bewusst. Dass Protagonisten von einem Tross Journalisten regelrecht gegrillt werden, so habe ich das nie wahrgenommen, als ich selbst Teil davon war. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Journalisten wollen das aber oft nicht wahrhaben.
Das Publikum offenbar auch nicht. Wenn man sich jedenfalls die Diskussionen anschaut, die rund um die Flüchtlingsthematik anschaut, da kann man verzweifeln. Wie sehen Sie das?
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie aus dem Odenwald. Ich war das erste von vier Kindern, das Abitur machen konnte, und die erste Frage meiner Eltern an die Lehrer war damals, was denn ein Gymnasium koste? Mir ist es als Sprecher nicht zuletzt deswegen sehr wichtig, vor allem die ganz normalen Menschen zu erreichen, die sich nicht den ganzen Tag, sondern vielleicht gar nicht mit dem Flüchtlingsthema beschäftigen.
Nehmen wir das Thema Wohnraum, das viele in Berlin umtreibt. Eine alleinerziehende Sachbearbeiterin der Krankenkasse findet in vielen Bezirken Berlins keine Wohnung mehr. Oder der BVG-Busfahrer, der alles tut, dass seine Kinder eine gute Schulkarriere meistern. Wenn Politik jetzt nur darüber redet, dass man Wohnraum für Flüchtlinge schaffen muss, dann führt das völlig nachvollziehbar zu Frustrationen. Ein Journalist mit festem Job beim Fernsehen und einer Altbauwohnung in Charlottenburg vergisst das auch mal gerne. Das wäre also auch ein Ansatz gewesen, den ich als Journalist gepflegt hätte: Welche Lösungen gibt es, mehr Wohnraum zu schaffen? Wie machen das andere Bundesländer?
Man muss die Menschen mitnehmen, meinen Sie das?
Menschen in Deutschland haben in den letzten 25 Jahren an Sicherheit verloren, das gilt für West wie für Ost. Die einen verloren ihren Job, die anderen die Sicherheit, dass man sein Leben planen und bis zur Rente beim gleichen Arbeitgeber aufsteigen kann. Bei vielen führte das zu dem Gefühl, jedwede Veränderung in der Gesellschaft bedrohe auch sie, und sei es ein Krieg in Syrien. Deshalb ist das Flüchtlingsthema so groß. Viele Antworten fehlen noch. Da sind wir noch nicht so richtig weiter gekommen.
Und jetzt kommt auch noch Köln dazu.
Dazu kann ich nichts sagen. Ich spreche für Berlin.
Können Sie eigentlich noch ruhig schlafen, seit Sie sich jeden Tag mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigen müssen?
Die ersten vier Wochen war es schwer, jetzt geht es aber. Und wenn ich um vier im Lageso sein muss, dann gehe ich halt um zehn ins Bett. Das geht schon.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Zukunft. Das Heft können Sie hier bestellen.