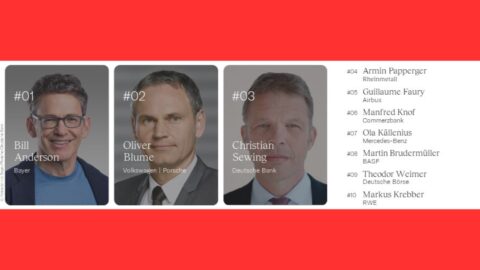Waren das noch Zeiten, als benzinbetriebene Mittelklassewagen geeignet schienen, das Umweltbewusstsein einer Automarke zu unterstreichen. Der Louis-Armstrong-Song „What a Wonderful World“ unterlegte in den späten Achtzigerjahren einen Werbespot des Autobauers Opel, in dem nicht ein bestimmtes Modell angepriesen wurde, sondern der serienmäßige Einbau geregelter Katalysatoren.
Wie so vieles aus jener Fernsehzeit – Michael Jackson, man erinnere sich, war damals prominentes Werbegesicht von Pepsi – sieht man den Spot heute mit anderen Augen. Verbrennungsmotoren sind nicht mehr Symbol ökologischer Nachhaltigkeit, sondern vielmehr das hinzunehmende Überbleibsel einer endenden Epoche. Und doch war die Opel-Werbung einer der Marksteine auf dem Weg zu einer Konsumentenöffentlichkeit, die sich nicht mehr nur allein für Produkte interessiert, sondern auch für deren Einfluss auf Mensch und Umwelt.
Heute könnte ein Autohersteller, der einen Werbespot mit dem ökologischen Pathos produzierte, wie es Opel seinerzeit an den Tag legte, sich wohl im Internet nicht mehr blicken lassen – ein Shitstorm wäre ihm garantiert. Von wegen wundervolle Welt …
Mehr als bloße Marketingmaßnahme
Auch wenn man es in den Achtzigern in Deutschland noch nicht so nannte, war die Opel-Werbung eine frühe Erscheinungsform dessen, was heute als Corporate Social Responsibility, kurz CSR, bezeichnet wird. Oder auch einfach als Nachhaltigkeit.
„Früher reichte es für Unternehmen aus, sich an geltende Gesetze zu halten, gute Produkte zu produzieren und Arbeitsplätze zu bieten, um in der öffentlichen moralischen Wahrnehmung bestehen zu können“, sagt der CSR-Experte und Professor an der International School of Management in Dortmund Arne Westermann. „Inzwischen erwartet man wesentlich mehr von ihnen: Sie sollen sich um Umweltschutz kümmern und soziale Verantwortung übernehmen, indem sie die Arbeitsbedingungen bei den ausländischen Zulieferern im Blick haben oder zumindest die Einhaltung der Menschenrechte garantieren.“
Wer CSR aber nur als Marketinginstrument begreife, das ohne eine entsprechende Unternehmenskultur auskomme, könne damit krachend scheitern, sagt Westermann. Das hat viel mit einem Megatrend des zurückliegenden Jahrzehnts zu tun: einer sich immer schneller austauschenden und dadurch sensibler werdenden Öffentlichkeit, die sich in Sozialen Medien, auf Bewertungsportalen und überall sonst im Netz tummelt.
Marken können von dieser Kulturveränderung profitieren, wenn sie diese Kommunikationskanäle zu nutzen wissen. Gleichzeitig kann der nächste Skandal hinter jeder Ecke lauern. Etwa dann, wenn bei einem Tausende Kilometer entfernten Lieferanten etwas katastrophal schiefläuft.
Der Schock von Bangladesch
Zum Beispiel in Bangladesch. Der Einsturz einer Textilfabrik mit mehr als 1.000 Toten war 2013 ein Weckruf nicht nur für die Textilbranche, sondern auch für die Politik. Im Jahr darauf forderte die EU ihre Mitgliedsstaaten auf, CSR-Regelungen für Unternehmen zu erlassen. 2017 trat in Deutschland ein Gesetz in Kraft, das große Unternehmen verpflichtet, CSR-Berichte zu ihren weltweiten ökologischen, menschenrechtlichen und sozialen Fußabdrücken zu erstellen.
Eine weitere Folge der Katastrophe von Bangladesch war die Gründung des „Bündnisses für nachhaltige Textilien“, das 2014 vom Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ins Leben gerufen wurde. Es ist eine der wichtigsten, aber bei weitem nicht die einzige Initiative, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. 130 Mitglieder hat das Bündnis heute, neben Textilunternehmen wie H&M, Adidas, Kik oder Rewe gehören dazu unter anderem auch Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. „Menschenrechtsverletzung, Umweltzerstörung und schlechte Arbeitsbedingungen sind heute sehr relevante Risikofaktoren für Unternehmen“, sagt Jürgen Janssen, der Leiter des Bündnis-Sekretariats. Unternehmen könnten es sich mittlerweile nicht mehr leisten, die Bedingungen, unter denen ihre Produkte entstehen, „zu ignorieren oder in den Verantwortungsbereich der Zulieferer auszulagern“, meint er.
Das „Bündnis für nachhaltige Textilien“ vergibt kein Siegel, betont Janssen. Es sei nicht dafür da, Mitgliedern Persilscheine auszustellen. Vielmehr wolle man ihnen ermöglichen, mit Experten aus allen gesellschaftlichen Bereichen und unter Beteiligung eines Bundesministeriums Strategien zu entwickeln, CSR und Nachhaltigkeit in die Unternehmensprozesse zu integrieren.
Konkret kann das etwa in Empfehlungen münden, wie die Standards bei Umweltschutz und Arbeitsbedingungen verbessert und kontrolliert werden können. Nachhaltig zu werden, ist für die Unternehmen im Bündnis also wichtiger, als Nachhaltigkeit zu kommunizieren. „CSR ist kerngeschäftsrelevant für die Unternehmen“, sagt Janssen.
Wie es laufen kann, wenn die Schere zwischen Markenbotschaft und unternehmerischem Handeln aufgeht, das zeigte in den vergangenen Jahren unter anderem der VW-Konzern. In einem Nachhaltigkeitsbericht propagierte dessen damaliger CEO Martin Winterkorn kurz vor seinem Abtritt „verantwortliches Handeln“ als unverzichtbar. Heute liegt in den USA wegen des Diesel-Betrugs ein (sehr nachhaltiger) Haftbefehl gegen ihn vor.
Externe CSR-Berater sind gefragt
Die CSR-Sensibilität wird steigen, das scheint sicher. Die heute 20-Jährigen wuchsen mit Sozialen Medien auf. Zudem ist die sogenannte „Generation Z“ hochpolitisiert. Vor allem wenn es um Umweltfragen und negative Begleiterscheinungen globalisierter Warenherstellung geht. Klassische Kommunikationswege, etwa über Pressestellen, erreichen junge Konsumenten nur noch schwer. Umso wichtiger sind die Sozialen Medien geworden. Botschaften können hier zwar abgesetzt, ihre weitere Verbreitung dann aber kaum gesteuert werden.
Um überhaupt einen Überblick über das öffentliche Stimmungsbild zu bekommen, scannen viele Unternehmen heute mithilfe von Algorithmen Soziale Medien. Trends und die Meinungen potenzieller Kunden werden so ausfindig gemacht, die eigene Reputation bei Nachhaltigkeitsthemen steht dabei besonders im Fokus.
Eine CSR-Strategie ergibt das natürlich noch nicht. Für diese Aufgabe setzt man vielerorts auf externe Berater. Einer von ihnen ist Norbert Taubken, Leiter von Scholz & Friends Reputation. Seiner Erfahrung nach hat sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren deutlich geändert, wie Unternehmen CSR interpretierten. „Zuerst ging es bei CSR darum, sich sozial zu engagieren, etwa durch Spenden oder Bildungsprojekte“, sagt Taubken. „Das Kerngeschäft eines Unternehmens war davon nicht berührt. Heute geht es darum, im Unternehmen selbst für Nachhaltigkeit zu sorgen.“
Auch Taubken warnt eindringlich davor, CSR vorrangig als Aufgabe der Kommunikationsabteilung zu begreifen, es vielleicht sogar dort einzugliedern. „Früher oder später werden einem sonst die Nachhaltigkeits- Botschaften um die Ohren fliegen. Dann nämlich, wenn sie im Unternehmen nicht gelebt werden und das nach außen dringt.“
Oder soll man es lassen?
Doch was spricht eigentlich dagegen, CSR einfach CSR sein zu lassen? Sich also um das Kerngeschäft zu kümmern, statt Nachhaltigkeitsberichte zu schreiben, die, seien wir ehrlich, außerhalb einer Fachszene kaum jemand liest. Nichts spricht dagegen, sagt Christopher Storck und ergänzt, um keinen Zweifel an seiner Haltung zu lassen, für ihn sei „CSR Teil des Problems, nicht der Lösung“.
Storck ist Partner der Strategieberatung Hering Schuppener und Professor für Kommunikationsmanagement an der Quadriga Hochschule. Er ist überzeugt, dass der Sinn von Unternehmen darin besteht, „Bedürfnisse und Herausforderungen von Menschen und Gesellschaften zu erkennen und mit kommerziellen Angeboten zu adressieren“.
Erfülle ein Unternehmen diese Aufgabe, sei es „nachhaltig erfolgreich“, sagt Storck. Es brauche dann „keine philanthropischen Aktivitäten jenseits seines Geschäfts zu entfalten“.
Auf der anderen Seite gebe es viele Unternehmen, die durch ihre Produkte mehr Schaden anrichteten, als sie Nutzen stifteten, sagt Storck. „Manche dieser gesellschaftlich sinnlosen Organisationen versuchen, mit CSR besser auszusehen, als sie handeln.“
Als Beispiel nennt der Kommunikationsexperte Getränkehersteller, deren Produkte weltweit Diabetes und Adipositas Vorschub leisteten – „die sich in ihren CSR-Reports aber dafür feiern, was sie der Menschheit Gutes tun“. Statt aufgesetzter Wohltätigkeit sollten Unternehmen besser Ziele formulieren, wie sie mit ihren Geschäftsaktivitäten zum Gemeinwohl beitragen wollen, fordert Storck. „Wer sein Kerngeschäft so ausrichtet, braucht keine CSR-Projekte.“
Die seit langem gepriesene wundervolle Welt, sie muss dann wohl weiter warten.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe VERANTWORTUNG. Das Heft können Sie hier bestellen.