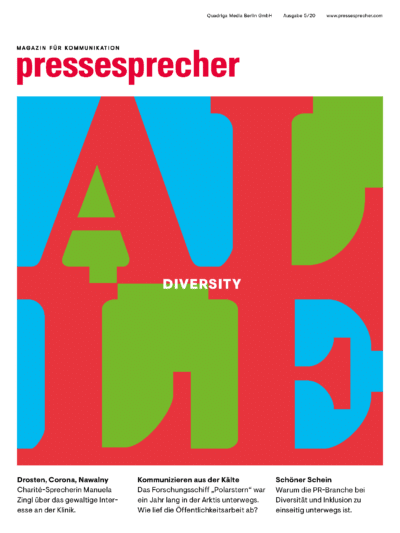Herr Kunert, viele Unternehmen schreiben sich Diversität auf die Fahne. Laut einer Studie meinen sie damit vor allem die Förderung von Frauen und die Einbeziehung von Menschen mit verschiedener kultureller Herkunft. Behinderungen spielen eine untergeordnete Rolle. Wie bewerten Sie das?
Heiko Kunert: Das ist bedauerlich. Aus Sicht der Personalgewinnung kann ich zwar nachvollziehen, dass man bei Inklusion zunächst auf die größte Gruppe setzt, also die der Frauen. Aber die Gruppe der Menschen mit Behinderung ist auch nicht gerade klein: Knapp jede*r Zehnte in Deutschland hat eine Schwerbehinderung. Und jede*r kann im Laufe seines Lebens behindert werden, etwa durch Krankheit oder einen Unfall. Die Gesellschaft tut sich keinen Gefallen, wenn sie der Inklusion von Menschen mit Behinderung einen vergleichsweise geringen Stellenwert einräumt.
Außerdem profitieren von Inklusion ja nicht nur die Menschen mit Behinderung, im Gegenteil: Ich finde, auch die Menschen ohne Behinderung sollten ein Recht auf Inklusion haben. Denn Vielfalt ermöglicht, Dinge neu zu denken.
Wie erklären Sie sich die Zurückhaltung von Unternehmen?
Es gibt viele Gründe. Zum Beispiel, dass Unternehmen voll leistungsfähige Arbeitskräfte suchen, aber viele Menschen mit Behinderung nicht eins zu eins die Leistung eines Mitarbeitenden ohne Behinderung erbringen können. Da ist Flexibilität gefragt, um auf die Stärken der Arbeitskraft mit Behinderung einzugehen und die Aufgaben im Team entsprechend zu verteilen. Dann profitieren alle. Dazu braucht es aber den Willen zur Veränderung, die sicher größer ist als bei anderen Gruppen. Es muss auch die Bereitschaft da sein, Zeit und Geld in einen barrierefreien Arbeitsplatz zu investieren.
Wobei dieser Aspekt in der Corona-geprägten Arbeitswelt, dem „New Normal“, künftig weniger ins Gewicht fallen könnte.
Ja, durchaus. Es darf aber nicht dazu führen, dass man die Menschen ins Homeoffice abschiebt. Das wäre keine Inklusion, sondern eine andere Form von Ausgrenzung. Das Problem sind bestehende Unsicherheiten und Vorurteile. Ich selbst habe es oft erlebt – sogar bei Geschäftsterminen in unserem Haus –, dass externe Gesprächspartner*innen ob meiner Blindheit irritiert reagiert haben. Die waren erst einmal überfordert. Ich glaube, in der Gesellschaft gibt es einfach viel Unwissen.
Dem entgegenzuwirken ist auch Aufgabe der Medien. Kürzlich schrieb „Bild“: „Was diese Menschen stark macht: Sie zeigen ihre Schwäche!“ und setzte unter der Abbildung eines Mannes den Satz „Auf den Fotos wird seine Beeinträchtigung mit Blindenstock und Rollator zur Superkraft“. Was geht da in Ihnen vor?
Das ist ein plakatives Beispiel. Es beschreibt das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege: der mitleidige Blick auf die Behinderung auf der einen und der heroisierende Blick auf der anderen Seite, das „Leben in absoluter Dunkelheit“ versus „das absolute Gehör“. Ich wünsche mir, man würde mehr die individuelle Perspektive herausarbeiten. Häufig zielt Berichterstattung über Menschen mit Behinderung auf die körperliche Einschränkung ab, weniger auf die gesellschaftspolitische Dimension, die Behinderung ja auch hat: Ich werde im Alltag meist nicht dadurch behindert, dass ich physisch nicht sehen kann, sondern durch das Verhalten nichtbehinderter Menschen oder fehlende Barrierefreiheit.
Sie wollten selbst einmal Journalist werden. Warum ist daraus nichts geworden?
Ich habe durchaus für einige Medien geschrieben und blogge auch. Während meines Politikstudiums in Hamburg habe ich den Bereich Unternehmenskommunikation kennengelernt und ein Praktikum in der Pressestelle einer Unternehmensberatung gemacht. Ich hatte Glück, dass die Firma gerade mit der Stiftung für Blinde und Sehbehinderte in Frankfurt kooperierte, die Studierende in Praktika vermittelte und die Hilfsmittel dafür stellte. Für das Unternehmen war das Werbung nach innen: Schaut mal, wir machen was Soziales. Das spielte auch eine Rolle damals.
Wie hat das Team auf Sie reagiert?
Das Erstaunen war schon groß, dass da jetzt ein blinder Mensch herumläuft. Aber Kommunikation ist alles. Wenn man ins Gespräch kam, wurde mir Hilfe angeboten. Ich konnte aber auch gut selbst deutlich machen, wo ich überhaupt Unterstützung benötige.
Nach dem Studium wurden Sie Pressereferent beim Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein und absolvierten eine Weiterbildung zum PR-Berater. Wie kommt man als blinder Kommunikator in einer zunehmend visuell geprägten Arbeitswelt zurecht?
Zunächst profitiere ich davon, dass Kommunikation meine Stärke ist. Ansonsten benutze ich technische Hilfsmittel wie einen Computer mit Sprachausgabe und eine Braillezeile, die den Bildschirminhalt in Blindenschrift wiedergibt. Außerdem habe ich eine Arbeitsassistentin. Sie übernimmt die Aufgaben, für die man sehen können muss. Sie ist aber keine PR-Fachkraft. Wenn es um die Bildauswahl für Social Media oder für Pressemitteilungen ging, war ich vorher auf sehende Kolleg*innen angewiesen. Da kam es auf ein gutes Vertrauensverhältnis an. Aber die Verantwortung hatte am Ende immer noch ich. Privat bin ich auch auf Instagram aktiv. Da unterstützt mich meine Frau.
Fällt es Ihnen leicht, um Hilfe zu bitten?
Als blinder Mensch bin ich auf Unterstützung angewiesen. Das ist Alltag für mich. Aber ich habe den Ehrgeiz, möglichst viel allein zu machen. Ich sitze dann schon mal eine Stunde länger an einem Projekt. Zum Beispiel habe ich mich nur mit meiner Hilfstechnik größtenteils allein in das CMS des Vereins eingearbeitet. Da hätten andere vielleicht schon früher um Hilfe gebeten. Häufig ist es übrigens so, dass nichtbehinderte Menschen glauben, wir benötigten Hilfe, wo wir sie tatsächlich gar nicht gebrauchen können.
Davon handelt auch ein Eintrag auf Ihrem Blog mit dem wütenden Titel „Euer Mitleid kotzt mich an“. Darin schildern Sie eine unangenehme Begegnung mit einer älteren Dame in der U-Bahn. Wie sehr nervt falsches Mitgefühl von Kolleg:innen?
(lacht) Das ist der meistgelesene Artikel auf meinem Blog, er ist sogar in Schulbüchern gedruckt worden. Im beruflichen Kontext erlebe ich falsches Mitleid in der Regel nicht. Normalerweise ist es so, dass meine Position, aus der heraus ich agiere – ob als Pressereferent oder jetzt als Geschäftsführer –, dominiert. Meine Blindheit ist eigentlich nur dann Thema, wenn es um Barrierefreiheit geht. Mitleid bis hin zu übergriffigem Verhalten erfahre ich eher im Alltag wie beim U-Bahn-Fahren oder beim Friseurbesuch. Da werde ich schon mal ungefragt angefasst oder irgendwohin geschoben.
Was kann die Unternehmenskommunikation zum Thema Inklusion beitragen?
Ich glaube, sehr viel. Zum einen können Kommunikationsverantwortliche dafür sorgen, dass sie Gesprächspartner*innen für die Medien divers auswählen. Es wäre doch toll, wenn da mal ein Mensch mit Behinderung zu Wort kommt, der nicht über seine Behinderung spricht, sondern über ein Fachthema – einfach weil er sich damit gut auskennt. Das andere ist die Barrierefreiheit, zum Beispiel in den Sozialen Medien.
Dazu engagieren Sie sich in der Initiative „Barrierefrei Posten“. Welche Tipps haben Sie für Unternehmen?
Zum Beispiel Bilder beim Hochladen auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. mit Alternativtexten zu versehen, die eine Sprachausgabe auslesen kann. Oder Videos für schwerhörige und gehörlose Menschen zu untertiteln. Und Einfache Sprache zu verwenden, sodass auch Menschen erreicht werden, die Lernschwierigkeiten haben oder unsere Sprache nicht so gut sprechen. Damit ist schon viel gewonnen und der Aufwand ist, mit etwas Übung, vergleichsweise gering.
Tipps für barrierefreie Postings
- Beim Hochladen eines Fotos eine Bildbeschreibung oder einen Alternativtext hinzufügen. Bei GIFs die Beschreibung in den Post oder als Reply einfügen.
- Mit einem „!B“ im Post darauf hinweisen, dass dieser Beitrag eine Bildbeschreibung enthält.
- Videos mit Untertiteln versehen, im besten Fall eins zu eins, aber maximal zwei Zeilen pro Untertitel.
- Kurze Sätze von acht bis zehn Wörtern schreiben und schwierige Wörter erklären.
- Bei Hashtags jedes Wort mit einem Großbuchstaben beginnen („#NurDerHSV“ anstatt „#nurderhsv“).
Sehen Sie sich eigentlich als Vorbild?
Ich tue mich schwer damit, das so zu formulieren. Ich sehe mich eher als Wegbereiter. In den Sozialen Medien habe ich schon kommuniziert, als das noch kein anderer Sehbehinderten- oder Blindenverein getan hat. Ich habe Vorträge über den Mehrwert von Social Media für Nischenthemen wie das unsere gehalten – hier erreichen wir Menschen, mit denen wir sonst nicht in den Dialog kommen. Da habe ich einiges bewegt.
Generell finde ich es wichtig, sichtbar zu machen, was mit Behinderung alles möglich ist. Das Internet ermöglicht es Menschen mit Behinderung, sich zu vernetzen. Wenn ich Tipps geben kann, freue ich mich.
Sie sind den Weg in die PR gegangen. Wünschen Sie sich Nachahmer:innen?
Unbedingt. Ich fände es super, wenn mehr Menschen mit Behinderung eine Chance bekämen, in der PR zu arbeiten – nicht nur wenn es darum geht, die Kommunikation barrierefrei zu machen oder ein Model im Rollstuhl zu zeigen. Sondern wenn Teams sich wirklich auf Inklusion einlassen, auch wenn das veränderte Arbeitsabläufe bedeutet. Ich kenne so viele Menschen mit Behinderung, die hervorragend ausgebildet sind, aber keine Arbeit finden. Dabei bringen sie oft viel Motivation und neue Perspektiven mit sich. Ihnen eine Chance zu geben, lohnt sich.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe DIVERSITY. Das Heft können Sie hier bestellen.