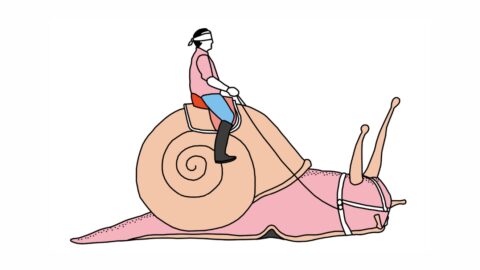Frau Kahmann, Unicef hat kürzlich bekanntgegeben, dass seit Kriegsbeginn fast zwei Drittel aller ukrainischen Kinder von zu Hause fliehen mussten. Ihr Kollege Manuel Fontaine, Leiter der Unicef-Nothilfe-Programme, hat gesagt, er habe in 31 Jahren humanitärer Arbeit noch nie eine so große Zahl geflohener Kinder in so kurzer Zeit gesehen. Wie haben Sie diese sechs Wochen erlebt?
Kahmann: Unicef ist seit 25 Jahren in der Ukraine tätig. Die Gewalt in der Region hat nie aufgehört, aber die brutale Eskalation des Krieges mit seinen furchtbaren Konsequenzen für die Menschen hat uns, glaube ich, alle überrascht. Wir haben praktisch unsere ganze Kommunikationsplanung umgeworfen. In den Monaten davor lag ein großer Fokus unserer Kommunikation auf der Krise in Afghanistan, wo über eine Million Kin-der lebensgefährlich mangelernährt sind. Ich war drei Wochen vor Kriegsbeginn von einem Besuch dort zurückgekehrt. Es ist uns sehr wichtig, dass die anderen Krisen jetzt nicht vergessen werden. Aber in den vergangenen Wochen haben wir uns im gesamten Team insbesondere auf die Situation der Kinder in der Ukraine fokussiert.
Welche Medienanfragen erreichen Sie in dem Zusammenhang?
Kahmann: Vor allem in den ersten Wochen haben sich die Anfragen auf Interviews und Gespräche mit den Kolleg*innen vor Ort konzentriert. Unsere Aufgabe ist es, Aufmerksamkeit auf die Situation der Kinder zu lenken und zu zeigen, was der Krieg mit ihnen macht. Als Nationalkomitee für Unicef arbeiten wir in engem Austausch mit den jeweiligen Länderbüros in der Ukraine und den Nachbarländern. Die stellvertretende Leiterin von Unicef in der Ukraine ist Deutsche: Michaela Bauer. Mit ihr ist insbesondere der Leiter unseres Presseteams, Rudi Tarneden, täglich per Whatsapp in Kontakt. Wir konnten sie direkt zu Kriegsbeginn strategisch in wichtigen Leitmedien platzieren, als viele Nachrichtenredaktionen nach Interviewpartnern gesucht haben.
Wie ist Unicef in der Ukraine aufgestellt?
Kahmann: Die genaue Zahl der Mitarbeitenden kommunizieren wir aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Wir hatten bereits vor dem Krieg ein Team von über 135 Mitarbeitenden, das seitdem aufgestockt wurde. Auch das Kommunikationsteam wurde verstärkt. Die Unicef-Kolleg*innen waren anfangs in Kiew, aber wir haben auch Teams an verschiedenen anderen Orten, auch im Osten der Ukraine. Aufgrund der Sicherheitslage wurde die Zentrale von Kiew nach Lwiw verlegt. Das ist aktuell das Drehkreuz für die Unicef-Hilfe. Gleichzeitig arbeiten wir mit einem großen Netzwerk an Partnern. Mobile Teams, die Rapid Response Teams, machen sich, wo immer möglich, ein Bild von der Lage in anderen Gebieten und passen die Hilfe dementsprechend an. Unsere internationalen Sprecher begleiten diese Teams teilweise und schicken uns Bilder und Videos.
Betreuen Sie deutsche Journalist*innen vor Ort? Oder macht das das Team in der Ukraine?
Kahmann: Wir koordinieren die Anfragen und geben das an die Kolleg*innen in der Ukraine weiter, insbesondere die Live-Schalten vor Ort. Wir versuchen, es den Kolleg*innen so einfach wie möglich zu machen, weil sie unter extremem Druck stehen und Gesprächsanfragen aus aller Welt erhalten. Sie probieren das dann zu ermöglichen. Das ist nicht immer einfach, die Situation ist je nach Ort gefährlich, auch der Strom ist kurz vor einer Schalte schon ausgefallen. Manchmal melden sie sich abends oder frühmorgens aus Schutzbunkern oder Kellern zurück.
Wie läuft die Bearbeitung einer Anfrage ab?
Kahmann: Die Ukraine-Anfragen erreichen meistens Rudi Tarneden und mich. Kurz nach Kriegsbeginn haben wir Kontakt mit einem TV-Leitmedium aufgenommen, da war Michaela Bauer noch in Kiew. Das Interview haben wir per Whatsapp abgestimmt. Wir haben täglich die internationalen Informationen von Unicef zusammen-gefasst und in einer morgendlichen Runde unsere Kolleg*innen über die neuesten Entwicklungen gebrieft.

Bekommen Sie viele Medienanfragen?
Kahmann: Unicef hat insgesamt eine starke Medienresonanz seit Beginn des Kriegs. Wir haben aber auch über unsere eigenen Kanäle und Partner kommuniziert. Die Solidarität der Menschen in Deutschland mit den Kindern in der Ukraine ist immens groß, der Krieg ist sehr präsent in den Medien. Ein bedeutender Beitrag für die Solidarität in Deutschland ist auch die Spendentafel des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe von Caritas International, DRK, Diakonie Katastrophenhilfe und Unicef im ZDF.
Über welche Kanäle erreichen Sie Ihre Zielgruppen jenseits der klassischen Pressearbeit?
Kahmann: Sowohl in Afghanistan als auch in der Ukraine haben wir unsere Unterstützer*innen über verschiedene Kanäle erreicht: zum Beispiel über die sozialen Medien und über Mailings an die mehr als 300.000 Paten, die regelmäßig an Unicef spenden. Auf unserer Website haben wir Blogs und Interviews mit Geschichten von Kindern veröffentlicht und waren auch durch Medienkooperationen etwa mit Ströer auf Infoscreens präsent.
Wie entscheiden Sie bei solchen Posts oder Beiträgen, was Sie in Bildern zeigen? Darüber gab es auch im Journalismus eine Debatte, nachdem die „New York Times“ eine getötete ukrainische Familie auf dem Titel hatte.
Kahmann: Bilder von getöteten Kindern oder von schwer verletzten Kindern, die keine Hilfe erhalten, sind für uns ein No-Go. Unicef hat sowohl international als auch hier in Deutschland Leitlinien darüber, wie wir mit Kindern und über Kinder kommunizieren. Kommunikation darf niemals das Leben eines Kindes oder seiner Familie in Gefahr bringen und muss die Würde der Kinder jederzeit respektieren. Wir informieren die Familien und die Kin-der vorher über die Verwendung der Bilder. Es braucht Einwilligungsbestätigungen. Ganz wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. In Videos lassen wir die Kinder möglichst selbst zu Wort kommen. Und wir zeigen auch ihre Not, beispielsweise haben wir neulich ein Bild von einem verletzten Jungen in einem Krankenhaus in Lwiw verwendet. Hier zeigen wir das verletzte Kind, aber wir kontextualisieren das Bild, in diesem konkreten Fall, indem der Junge bereits Hilfe im Krankenhaus erfahren hat.
Diskutieren Sie häufig über bestimmte Bilder?
Kahmann: Die Bilder, die wir aus der Ukraine erhalten, werden von Kolleg*innen aufgenommen, die diese Leitlinien kennen und respektieren. Wir haben aber schon Diskussionen in Bezug auf andere Krisen gehabt, zum Beispiel bei mangelernährten Kindern, deren Leben an einem seidenen Faden hängt. Auch da geht es darum, dass man die Kinder würdevoll fotografiert – also zum Beispiel zusammen mit ihrer Mutter. Es ist wichtig, den Umgang mit Bildern immer wieder zu besprechen, weil es uns als Kinderrechteorganisation so wichtig ist, respektvoll mit diesen Situationen umzugehen.
Hat sich das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewandelt?
Kahmann: Auf jeden Fall. Da hat sich sowohl im gesellschaftlichen Bewusst-sein viel getan als auch bei den verschiedenen Organisationen. Ich bin schon länger in diesem Sektor tätig, und vor Jahren wurden beispielsweise noch viel mehr Bilder verwendet, die die Diversität der Helfer*innen nicht immer berücksichtigt haben.
Aber das Leid muss man schon zeigen, um die Situation zu verdeutlichen?
Kahmann: Genau. Deswegen ist der Kontext der Bilder so wichtig. Natürlich geht es auch darum, die Not der Kinder zu veranschaulichen, aber wir respektieren ihre Würde jederzeit. Ein hilfreicher Leitsatz dabei ist immer die Frage an uns selbst: Was, wenn es mein Kind wäre? Wir erzählen auch die Geschichten von Kindern in schwierigen Situationen, von Kindern, die allein auf der Flucht sind, aber da würden wir nie den vollen Namen veröffentlichen und in der Regel nicht das Gesicht zeigen. Wenn Medien Kinder mit Unicef filmen oder fotografieren, legen wir Wert darauf, dass diese Regeln eingehalten werden.
Haben die Medien ein besonderes Interesse an persönlichen Geschichten?
Kahmann: Es gibt Interesse, persönlich mit Familien zu sprechen oder an persönlichen Geschichten. Aber viele Medien sind selbst vor Ort und leiten das in die Wege. Sie fragen uns als Unicef dann eher nach einer Einordnung der Gesamtsituation der Kinder. Unsere Kolleg*innen vor Ort schildern aber auch sehr persönlich, was der Krieg mit den Kindern macht. Unser Unicef-Nothilfeleiter, Manuel Fontaine, hat eine sehr traurige Geschichte erzählt von einem Jun-gen, der mit zehn Menschen in einem Auto aus Mariupol geflohen ist, das dann unter Beschuss geriet. Er liegt jetzt mit zwei Schusswunden im Bauch im Krankenhaus. Dieser Junge hat überlebt. Viel zu viele andere Kinder nicht. Solche Geschichten und Schicksale bewegen auch uns sehr, obwohl wir uns täglich mit der Situation beschäftigen.
Beobachten Sie dennoch einen Abstumpfungseffekt aufseiten der Medien und der Öffentlichkeit?
Kahmann: Grundsätzlich zeigen die Menschen in Deutschland und rund um die Welt eine enorme Solidarität. Es kann sein, dass es einen Abstumpfungseffekt gibt, je länger der Krieg dauert. Aber ich würde nicht sagen, dass damit die Solidarität verschwinden muss. Das ist auch unsere Rolle als Unicef, langfristig dafür zu sorgen, dass Krisen nicht vergessen werden.
Wie stellen Sie das sicher?
Kahmann: Ich bin zum Beispiel weiterhin eng im Austausch mit den Kolleg*innen in Afghanistan. Es gibt viele weitere vergessene Krisen, die nicht im Fokus der Berichterstattung stehen, wie im Jemen oder in Somalia. Dazu kommen die Herausforderungen durch den Klimawandel und die drohende Hungersnot am Horn von Afrika. Darüber probieren wir weiter zu informieren. Ich befürchte aber, dass uns die Situation in der Ukraine noch lange beschäftigen wird.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe #Agenturen. Das Heft können Sie hier bestellen.