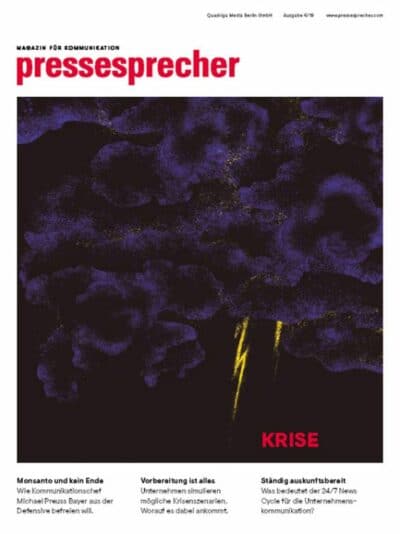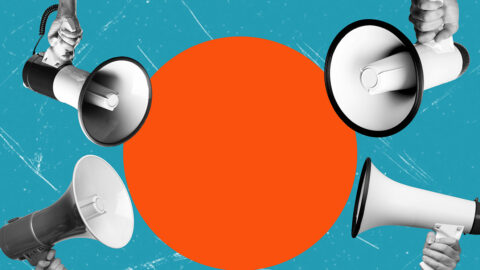Herr Beck, in welchen Momenten entwickeln Sie die besten Ideen oder gar Visionen?
Henning Beck: Ich lebe in Frankfurt und fahre regelmäßig mit meinem Rennrad ins Grüne. Meistens überlege ich mir im Vorfeld, was mich beschäftigt und welche Frage ich mir stellen will. Dann fahre ich los. Beim Radfahren kann ich komplett abschalten. Die Ideen kommen dann nachher, wenn ich etwas esse oder unter der Dusche stehe.
Was ist visionäres Denken? Was macht es aus?
Es gibt im Gehirn kein Visionsareal. Eher ist es eine Kombination aus verschiedenen Denkwegen. Eine wichtige Eigenschaft des visionären Denkens ist, sich zu überlegen: „Was wäre, wenn?“ Dass man Hypothesen aufstellt, sich in neue Situationen hineinversetzt, Dinge ausprobiert, aus Fehlern lernt. Das ist die Basis für visionäres Denken. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Gedankenexperimente durchführen kann – sich ein Szenario vorstellen und überlegen, wie das endet.
Was passiert im Gehirn, wenn man anfängt, Ideen oder Visionen zu entwickeln?
Zunächst brauche ich ein Problem, das mich nervt und unzufrieden macht. Mit diesem Problem muss ich mich auseinandersetzen und Fragen stellen. Dann kommt meist der Punkt, an dem ich mit meinen Fragen nicht weiterkomme. Dann gehe ich auf Distanz zum Thema. Meist sitzt man da im Auto, steht unter der Dusche oder macht Sport. In solchen Momenten wird im Unterbewusstsein mein Wissen kombiniert. Gedanken und Ideen entwickeln sich. Diese unbewussten Gedanken werden durch das sogenannte Kontrollnetzwerk im Stirnbereich gefiltert. Erst anschließend werden sie bewusst. Diese Balance zwischen Kontrolle und Ablenkung ist entscheidend, um auf gute Ideen zu kommen.
Kann man Kreativität trainieren?
Man kann sich auf dieses Wechselspiel zwischen den Hirnregionen konzentrieren. Sich mit einem Problem beschäftigen und sich dann davon distanzieren. Der Rapper Eminem beispielsweise arbeitet von morgens um 9 Uhr bis nachmittags um 17 Uhr. Dabei macht er immer bewusste Pausen. Er schafft so diese wichtige Balance zwischen Konzentration, Ablenkung und Wiederkehr zu einem Problem.
Sie sprechen von Problemen, die es braucht, um neue Ideen zu entwickeln. Was meinen Sie damit?
Jede gute Vision, jede gute Idee beginnt mit Schmerz. Dass Sie sich über etwas aufregen und ein Problem haben. Wenn man glücklich und zufrieden ist, braucht man sich nicht ändern und muss nicht kreativ sein. Probleme annehmen, sie attackieren und sich die Frage stellen: Wofür kann ich die Dinge, die ich habe, einsetzen? In welchem Problemfeld?
Warum werden die einen Visionäre, andere hingegen nicht? Gibt es da biologische Dispositionen?
Man wird nicht als Visionär geboren. Eher sind wir umgeben von Systemen, die visionsfeindlich sind – sei es in der Erziehung oder im Bildungssystem. Vielen Menschen wird abtrainiert, visionär zu denken. In unserer Gesellschaft geht es in erster Linie darum, dass wir Dinge effizient lernen, anwenden und dass wir funktionieren. Wir werden darauf trainiert, Fehler zu vermeiden und Sicherheit zu bevorzugen. Wir werden nicht für das Risiko ermutigt. Das allerdings führt dazu, Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Warum unterstützt unser gesellschaftliches System uns so wenig darin, visionär zu denken?
Menschen, die wir als Visionär bezeichnen, sind meistens unbequem – wie Steve Jobs, Elon Musk oder andere Unternehmer und Wissenschaftler. Sie stellen Abläufe, Prozesse oder Autoritäten infrage – mit denen will man eher nicht zusammenarbeiten.
Welche Eigenschaften bringen Visionäre wie Steve Jobs oder Leonardo da Vinci neben ihrer Durchsetzungskraft mit?
Visionäre haben in der Regel ein breites Wissen. Sie haben viele Dinge gelernt, von denen sie vielleicht gar nicht dachten, dass man sie brauchen kann. Leonardo da Vinci war unter anderem Maler, Bildhauer, Architekt, Ingenieur – ein Universalgelehrter. Steve Jobs besuchte an der Universität unter anderem einen Kalligrafie-Kurs, dessen Grundlagen er erst zehn Jahre später für das Design des Macintosh nutzte.
Je mehr ich also weiß, desto innovativer kann ich denken?
Ja. Ich brauche eine gute Allgemeinbildung, auf der ich aufbauen kann. Dieses teils unnütze Wissen kann ich dann auf andere Sachen übertragen. Eine zu frühe Expertise engt mich in meinem Denken ein.
In welchen Momenten entwickeln Menschen Ideen?
Wenn sie alleine sind. Oder wenn sie sich vorher mit anderen ausgetauscht haben. Fragt man Menschen, woher ihre Ideen kommen, nennen sie oft Situationen, in denen sie für sich sind. Das kann unter der Dusche sein, beim Autofahren, beim Sport oder im Flugzeug.
Orte, wo das Gehirn im besten Fall Ruhe finden kann.
Menschen werden einfallsreicher, wenn sie sich inspiriert oder miteinander ausgetauscht haben. Daneben braucht das Gehirn auch die Zeit, um das zu verdauen. Erst dann macht es Informationen zu Wissen und es entstehen Ideen.
PRler, Kommunikatoren und CEOs sind dafür bekannt, permanent erreichbar und multitaskingfähig zu sein. Wie fördernd ist das für Kreativität?
Multitasking ist nicht nur der Feind von Kreativität, sondern von Denken generell. Man kann beispielsweise nicht parallel zwei Fernsehsendungen schauen oder zwei Artikel lesen. Sie müssen immer hin- und herspringen. Dabei brauchen Sie immer einen kurzen Moment, um sich zu konzentrieren. Wenn Menschen viel hin- und herspringen, viel erreichbar sind, werden sie vergesslicher und unkonzentrierter.
Wie können Unternehmen oder Agenturen ihre Mitarbeiter fördern, kreativ zu sein?
Erstmal sollte man sich die Frage stellen, ob man es überhaupt will, dass Mitarbeiter kreativ sind. Kreative Leute sind unbequem. Wenn ich möchte, dass Leute gute Ideen für Produkte oder Slogans entwickeln, muss ich bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Dazu gehören Widersprüche und Konflikte.
Und wenn sich Unternehmen für kreative Mitarbeiter entschieden haben?
Zu sagen: „Leute, seid kreativ!“, reicht nicht aus. Sie brauchen ein Problem, eine Fragestellung. Damit ermutigt man sie, sich selbst Fragen zu stellen. Man sollte ihnen die Freiheit gewähren, in alle Richtungen zu denken. Das ist wichtig, weil sie sonst in ihrem Denken geframed oder eingeschränkt sind.
Wie sieht das ideale Arbeitsumfeld aus, um neue Gedanken zu entwickeln?
Die beste Umgebung ist da, wo ich Räume wechseln kann. Wie ein mittelalterliches Kloster, in dem es drei Bereiche gibt. Es gibt meist einen zentralen Garten, der der Entspannung dient. Dieser Garten ist von einem Kreuzgang umrundet, wo man sich miteinander austauschen kann. Von diesem Gang gehen Schreibstuben ab, wohin man sich zurückziehen kann. Es kommt nicht auf den Raum an, sondern auf die Möglichkeit, zwischen Räumen hin- und herzugehen. Der Mensch denkt so, wie der Raum es ihm vorgibt.
Sehen Sie die Idee des Klosters in modernen Büros mit Kreativraum, Sofaecke und Tischkicker umgesetzt?
Entscheidend ist, dass ich den Raumwechsel habe. Wenn ich den nicht habe, dann bringe ich auch nie diesen Twist ins Denken rein und komme auf neue Gedanken. Da reicht es manchmal schon, einfach in der Kaffeeküche abzuhängen.
Was halten Sie von Brainstormings oder Kreativmeetings?
In Gruppen blockiert man sich oft gegenseitig. Es stehen sich Eitelkeiten gegenüber: Der eine hält zu sehr an seiner Idee fest. Andere nehmen sich zurück. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Menschen in Gruppen durchschnittlich 15 IQ-Punkte verlieren. Weil man sich eben zu sehr an der Gruppe orientiert und nicht mehr das Maximale aus seinen Möglichkeiten macht.
Also werden Brainstormings überbewertet?
Nein. Aber es ist sinnvoller, sich zusammenzusetzen, um ein Problem zu finden und nicht die Idee. Man kann sich gerne die Köpfe heißreden und dann auch genervt abbrechen. Wichtig ist, dass sich jeder Einzelne separat nochmal sammelt, um dann wieder in die Gruppe zu gehen und seine Ideen vorzustellen.
Sie sagen, dass es zwischen visionärem Denken und Alter einen Zusammenhang gibt. Wie meinen Sie das?
Junge Menschen probieren mehr aus, fallen aber auch schneller auf die Nase. Ältere Menschen trauen sich in der Regel weniger, weil sie beispielsweise eine Familie ernähren und das Haus abbezahlen müssen. Deswegen sind Menschen im mittleren Alter, also um die 30, besonders erfolgreich, wenn es darum geht, Unternehmen zu gründen oder Dinge auszuprobieren.
Sie selbst haben Start-ups bei der Entwicklung moderner innovativer Kommunikationskonzepte unterstützt. Herrscht in den USA ein besonders innovationsfreundliches Klima?
In Kalifornien gibt es die Mentalität, mehr auszuprobieren. Wer hinfällt, darf auch wieder aufstehen und man lernt aus seinen Fehlern. Hierzulande versucht man eher, den Fehler von Anfang an zu vermeiden. Wir haben in Deutschland nach wie vor ein gutes Bildungssystem und Ingenieure, die sehr gute Produkte entwickeln. Wir sollten mehr in Prozesse der Ideenfindung investieren – auch wenn die Ideen erstmal scheitern. Aber ohne diesen Prozess kann eben auch nichts Neues und Großes entstehen.
Herr Beck, was war die beste Idee, die Sie jemals hatten?
Es ist eher ein Perspektivwechsel, der mich als Grundidee mein Leben begleitet. Als Schüler tüftelte ich mit meinem damaligen Chemielehrer über einer Aufgabe. Es waren seine Fragen und weniger die Antworten, mit denen ich die Aufgabe selbstständig löste. Wenn wir immer perfekt wären und niemals einen Fehler machen würden, würden wir nie auf gute Ideen kommen. Das Ausprobieren ist viel wichtiger als das perfekte Machen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KRISE. Das Heft können Sie hier bestellen.