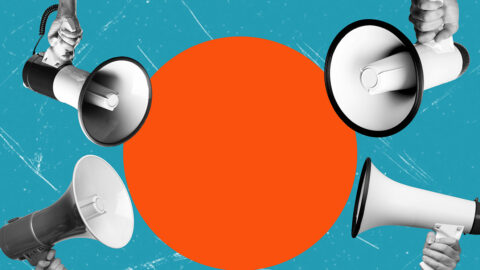David Wagners Job ist das, was gefühlt halb Deutschland vom Arbeiten abhält: Facebook und Co. An der German Graduate School of Management and Law in Heilbronn beschäftigt er sich als Assistant Professor schwerpunktmäßig mit Social Media und Online-Communitys. Und das ist eben mehr, als die fast schon senil klingende Redewendung „Facebook und Co.“ vermuten lässt, macht Wagner im Interview klar. Social Media muss man ernst nehmen, sagt er. Denn Unternehmen könnten damit nicht nur nach außen auftreten, sondern auch die eigene Entwicklung nach vorne bringen. Dazu allerdings, betont Wagner, dürften Pressesprecher mit dem Thema nicht alleine gelassen werden.
Herr Wagner, Sie forschen zu sozialen Netzwerken, also zu etwas, bei dem sich fast jeder unter 40 perfekt auszukennen meint. Seit wann sind Sie dabei?
David Wagner: 2006, nach dem Studium, kam ich zur Deutschen Handelskammer in Ecuador, später zu der in Kanada. Dort war ich für die Kommunikationsarbeit zuständig und habe schnell gemerkt, dass sich im Bereich Social Media viel tut. Ich habe dann relativ schnell mit Twitter angefangen und gute Erfahrungen gemacht.
Es ging Ihnen also vor allem darum, Informationen nach draußen zu bringen?
Ja, jedenfalls zu meiner Zeit als professioneller Kommunikator. In meiner Rolle als Wissenschaftler weiß ich Social Media nun auch als Recherchequelle sehr zu schätzen. Ich folge zum Beispiel den einschlägigen Forschern meines Fachbereichs auf Twitter, weil ich dann sehr schnell mitbekomme, wenn es neue, relevante Publikationen gibt. Darüber hinaus kann ich zum Beispiel Konferenzen virtuell verfolgen, ohne physisch anwesend zu sein.
Twitter haben Sie genannt, dazu noch Facebook: Schon hat man den gesamten Social-Media-Kosmos beschrieben, den manch einer in der Branche auf dem Schirm hat, oder?
Mit einem Team vom Bundesverband für Community Management und Social Media habe ich im vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt. Wir fanden heraus, dass Facebook, Twitter und Google Plus tatsächlich die drei meistgenutzten Plattformen sind. Bedingt durch die Dominanz dieser drei Netzwerke ist der Reflex, da als Kommunikationsabteilung zuerst anzudocken, auch gar nicht so falsch. Aber das darf dann natürlich nicht alles sein. Man muss schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt und was zum eigenen Profil passt. Wenn ich eher ältere Nutzer ansprechen will, bringt es wahrscheinlich nicht viel, auf Periscope aktiv zu sein.
Das klingt nach verdammt viel Recherche. Der arme Referent, kann der das alles leisten?
Es ist eine komplexe Aufgabe. Und daher ist es nicht ratsam, das nebenbei zu erledigen – weil es so furchtbar schiefgehen kann. Die größeren Unternehmen haben das aber schon erkannt und eigene Social-Media-Verantwortliche eingestellt. Für Sprecher von kleinen Unternehmen ist es aber schon eine ganz schöne Herausforderung.
Vielleicht auch eine Überforderung?
Nicht, wenn man sich fokussiert und die Dinge macht, die gut funktionieren. Außerdem kann man sich ja auch externe Unterstützung holen. Aber man muss auch sagen, dass für Social Media nicht nur die PR- und Marketing-Abteilungen alleine zuständig sind.
Wie meinen Sie das?
Die beiden Abteilungen waren sehr lange Vorreiter, ging es um die digitale Kommunikation. Jetzt erweitern sich aber das Verständnis und der Anspruch von Social Media. Es geht nicht mehr nur darum, digital nach außen zu kommunizieren, sondern Informationen innerhalb des Unternehmens zu verteilen oder auch von außen nach innen zu holen – kurzum: zu vernetzen. Bei größer angelegten Digitalinitiativen müssen deshalb auch alle anderen Fachabteilungen die Ärmel hochkrempeln, denn das geht erheblich über das Kerngebiet von Pressesprechern hinaus.
Ich nehme an, es geht jetzt nicht mehr um Facebook?
Es gibt zum Beispiel Communitys, in denen sich Kunden über verschiedene Themen austauschen können, die eng mit den Produkten eines Unternehmens zusammenhängen. Die Technik-Community des Elektronikhändlers Conrad ist ein gutes Beispiel, weil hier Kunden aus einer eigenen Motivation heraus die Marktforschung des Unternehmens unterstützen. Gleichzeitig erreicht Conrad auf diese Weise bei vielen Nutzern einen hohen Grad der Identifikation. Das ist dann natürlich ein völlig anderes Setting als bei Facebook, sowohl was die Ziele, die Zielgruppe als auch die Mittel angeht.
Und was gibt es noch?
Auch bei internen Netzwerken passiert viel. Da geht es darum, Mitarbeiter in die Entwicklung von Produkten einzubinden, neue Ideen zu generieren. Außerdem noch die Innovations-Communitys: Innocentive oder Openideo wären da zu nennen. Hier veröffentlichen Unternehmen Problemstellungen, die sie gerade bearbeiten, und alle sind aufgerufen, Lösungen zu finden. Findet sich eine, gibt es eine Prämie.
Was ganz eindrücklich zeigt, dass sich Social Media inzwischen in einem sehr weiten Feld bewegt. Realität bei manchem Unternehmen sind allerdings die berüchtigten Link-Friedhöfe. Da wird dann alles bei Facebook und Twitter eingestellt, was man in die Hände bekommt. Ohne dann aber auf eine weitere Interaktion Wert zu legen.
Ja, das gibt es, ein echter Kardinalfehler. Social Media lebt ja von Interaktivität. Fehlt die, verlieren Nutzer schnell die Lust, sich einzubringen. So ein Auftritt ist dann schlechter als gar kein Auftritt.
Gibt es eigentlich eine Faustregel, mit welchen Posts man besondere Aufmerksamkeit erzielt?
Es heißt nicht umsonst Social Media. Es sollte menscheln, Gefühle müssen vermittelt werden. Dazu gehört, Kommunikation auf Augenhöhe zu pflegen, was nicht mit einem Duz-Zwang verwechselt werden sollte. Nutzer wollen das Gefühl haben, dass sie wahrgenommen und ihre Fragen auch beantwortet werden. Daraus entsteht Kommunikation erst, mit einem rein formalen Stil bekommt man das nicht hin.
Das größte Rätsel ist für viele, die sich länger damit beschäftigen, sowieso der Algorithmus bei Facebook. Der ist geheim, wird offenbar ständig verändert und sorgt dafür, dass der eine Post abgeht und der andere ohne erkennbaren Grund sofort verendet. Können Sie hier bitte mal sagen, wie der Algorithmus lautet?
Nein, leider nicht. Verschiedene Details zu den Änderungen werden zwar bekannt gemacht, aber nie alle. Das Resultat ist dann ein Raten und Probieren. Man macht sich eben abhängig, wenn man sich auf einen fremden Kanal verlässt. Ich plädiere deshalb für einen ausgeglichenen Mix der Social-Media-Kanäle, der immer auch mindestens einen eigenen mit einschließt. Im Umkehrschluss bedeutet das: Je strategischer der Nutzen einer Community für ein Unternehmen, desto wichtiger ist es, die Hoheit darüber zu haben.
Sie bieten auch Social-Media-Seminare für Kommunikatoren an. Gibt es ihn eigentlich noch, den berüchtigten Verweigerer, der das alles rundherum ablehnt?
Und ob. Das ist sicher auch eine Generationenfrage. Bei den Älteren ist da nicht jeder Feuer und Flamme. Die Branche spielt sicher auch eine Rolle. Traditionelle Zweige wie der Maschinen- und Anlagenbau, sogar die Automobilbranche, sind erfahrungsgemäß keine digitalen Vorreiter. Ich will das aber nicht verurteilen. Sondern verdeutlichen, dass man heute digitale Technologie im Blick haben muss und sie verstehen sollte, bevor man sie ablehnt. Vor fünf Jahren hätte kein Taxifahrer gedacht, dass sein Berufsstand gefährdet sein könnte. Heute gibt es Uber und bald das selbstfahrende Auto. Man kann Entwicklungen sehr schnell verschlafen. Das gilt auch für Kommunikationsabteilungen.
"Für Social Media sind nicht nur die PR- und Marketingabteilung allein zuständig"
Interview

(c) Thinkstock/Hilch
Lesezeit
4 Minuten
Erschienen am
12.12.2016
Weitere aktuelle Jobangebote