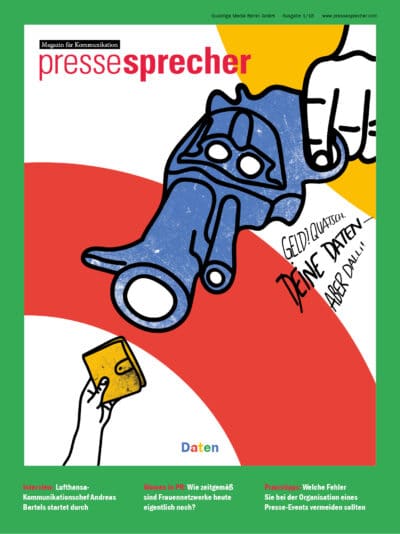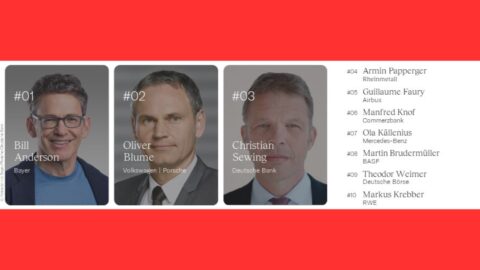So recht einordnen konnte Christina Rettig das nicht: Der Mann aus Südkorea sprach einfach nicht mit ihr. Seit acht Jahren arbeitet Rettig beim weltweit operierenden Spezialglashersteller Schott, sie leitet dort heute die Technologie- und Innovationskommunikation, hat internationale Kommunikationserfahrung. Aber warum der potenzielle Geschäftspartner in Fernost sämtliche Kommunikation über einen Mittelsmann laufen ließ, „konnte ich mir einfach nicht erklären“.
Bis Rettig von einem in Südkorea lebenden Deutschen erklärt bekam, dass das Einsetzen eines Mittelsmanns kein Ausdruck von Desinteresse sei, sondern eine Art Rückversicherung. Denn sollte es knirschen, könnte der potenzielle südkoreanische Geschäftspartner auf eine missverständliche Übermittlung verweisen − eine in dem Land übliche Praxis, wie Rettig erfuhr.
Das Geschäft kam letztlich zustande, von Desinteresse konnte fortan keine Rede sein. Rettig sagt: „So etwas passiert in der internationalen Kommunikation ständig.“
International zu agieren, ist für immer mehr Kommunikatoren Alltag. Deutsche Mittelständler wie Schott machen weltweit Geschäfte, ausländische Konzerne haben deutsche Dependancen, die Globalisierung tut ihr Übriges. Von der Illusion, mit einer einheitlichen, von der Zentrale festgelegten Kommunikationsstrategie weltweit agieren zu können, hat man sich in den allermeisten Fällen verabschiedet.
Kommunikationsteams vor Ort bekommen mehr Bewegungsund Entscheidungsfreiheit. Schon allein deshalb, weil es wie im Falle von Schott gar nicht möglich ist, mit nicht einmal einem Dutzend Mitarbeitern in der Kommunikationsabteilung 30 Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit adäquat zu bedienen.
Amerikanische PR funktioniert anders
Wobei, so selbstverständlich ist der Kulturwandel dann vielleicht doch noch nicht. Romy Fröhlich ist Professorin für Kommunikationswissenschaften an der LMU in München, sie beschäftigt sich unter anderem mit Organisationskommunikation. Von ehemaligen Studierenden hört sie immer wieder, „wie erschreckend einseitig in vielen Unternehmen noch von der Zentrale in die Niederlassungen kommuniziert wird“.
Als Beispiel nennt Fröhlich amerikanische Unternehmen, die ihren europäischen Niederlassungen Pressemitteilungen servieren und sich dann von einer Eins-zu-eins-Übersetzung gleiche Effekte wie in den USA erhoff en. „Sie übersehen, dass amerikanische PR in Deutschland als reines Marketing wahrgenommen wird. Dafür begeistert man hierzulande keine Journalisten.“ Die Botschaft verendet dann irgendwo über dem Atlantik.
Thomas Mickeleit spricht von US-amerikanischen Pressemitteilungen, die „viel weniger faktenorientiert sind, als das bei uns erwartet wird“. Mickeleit ist Director of Communications bei Microsoft Deutschland. Grundsätzlich, sagt er, seien die Kulturunterschiede zwischen der Microsoft-Zentrale in den USA und Deutschland gar nicht so groß, aber in Details eben doch spürbar.
Mickeleit steht für eine selbstbewusste Dependance. „Wir haben früher viel häufiger Texte übersetzt und sind dann ein oder zwei Tage später mit einer lokalisierten Meldung rausgegangen“, beschreibt er das lange praktizierte Einbahnstraßenprinzip. „Das funktioniert nicht mehr.“ Heute schreibe sein Team über „lokale Inhalte“, in denen dann auf die US-Quelle verlinkt werde.
Das kommt Journalisten im Tech-Bereich doppelt entgegen: Sie sind es gewohnt, auf amerikanische Quellen zurückzugreifen, gleichzeitig aber immer auf der Suche nach dem „nationalen Aufhänger“.
Die Zentrale darf nicht zum Nadelöhr werden
„Freedom within a framework“ nennt Merlin Koene das. Koene ist Experte für internationale Kommunikation, er betreute den Bereich lange für den Weltkonzern Unilever. „Gerade wenn ein internationaler Konzern möchte, dass in allen Ländern die gleiche Botschaft ankommt, muss er diese Botschaften an nationale Märkte anpassen“, sagt Koene.
Was dies praktisch bedeutet, war kürzlich zu erleben, als der kanadische Konzern Bombardier in der Lausitz Massenentlassungen nicht kommunizierte, sondern: verkündete.
Bei Siemens hat man sich die internationale Expertise jetzt einfach in die Zentrale geholt. Aus einem rein deutschen Leitungsteam der Kommunikationsabteilung ist 2017 eines mit 50 Prozent Ausländeranteil geworden, berichtet Kommunikationschefin Clarissa Haller. Und die Spitzen der weltweiten Presseteams sprechen anders als vorher gleichberechtigt in den zentralen Kommunikationskonferenzen in München.
„Das sind ganz andere Diskussionen“, sagt Haller. Zum Beispiel im chinesischen Markt mit eigenen politischen und kulturellen Regeln sei das Gold wert. In Zeiten temporeicher Social-Media-Kommunikation sei es aber sowieso nicht mehr möglich, „alles über München laufen zu lassen“, betont Haller: „Sonst wird die Zentrale zum Nadelöhr, das andere ausbremst.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe DATEN. Das Heft können Sie hier bestellen.