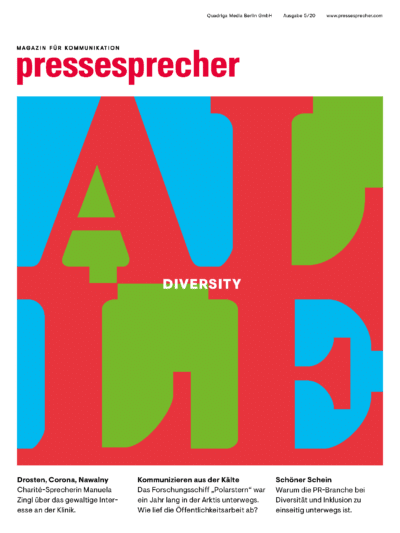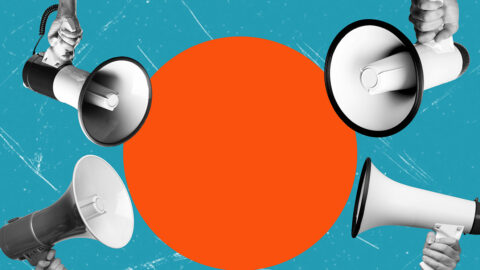Frau Zingl, auf Ihrer Website steht der Hinweis, dass aufgrund des Coronavirus das Aufkommen von Anfragen außergewöhnlich hoch sei. Wie viele Anfragen bekommen Sie zu einer Pressemitteilung wie „Maulwürfe: intersexuell und genetisch gedopt“? Wie viele zu Corona und Christian Drosten?
Manuela Zingl: Bei unserer Pressemitteilung zu den Maulwürfen handelt es sich um Wissenschaftskommunikation. Dort sind die Kontaktdaten der beteiligten Wissenschaftler angegeben, daher kann ich ad hoc nicht sagen, wie viele Anfragen nach der Veröffentlichung eingegangen sind. Bei den Corona-Themen und Christian Drosten schwanken die Journalistenanfragen zwischen zehn und 50 pro Tag. Bei unserer Themenvielfalt stehen bei uns die Telefone nie still.
Wir führen dieses Gespräch am 21. Oktober. Die Zahl an Coronavirus-Infektionen steigt. Was wollen Medien aktuell von Ihnen wissen?
Zurzeit interessiert die Medien vor allem die Situation in der Charité: wie viele Covid-19-Patienten wir intensivmedizinisch behandeln. Wie der Altersdurchschnitt der Patienten ist und ob die schweren Krankheitsverläufe zunehmen. Häufig wird gefragt, wie viele Betten noch frei sind. Man merkt, dass eine gewisse Anspannung in der Öffentlichkeit vorhanden ist. Es gibt eine Parallele zur Situation im März. Es herrscht ein Gefühl, dass noch etwas auf uns zukommt. Aber noch haben wir es in der Hand.
Haben Sie deshalb vor kurzem eine Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz gegeben, auf der Vertreter der Charité auf Personalmängel in der Intensivpflege hingewiesen haben?
Ja. Dort sprachen unter anderem unser Vorstandsvorsitzender Professor Kroemer, unser Vorstand Krankenversorgung Professor Frei, Christian Drosten, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, aber auch ein Vertreter vom Universitätsklinikum Frankfurt. Das war eine gezielte kommunikative Maßnahme, um noch einmal dafür zu sensibilisieren, dass die Fallzahlen bundesweit nach oben gehen. Vom Timing her war das richtig, weil ab diesem Moment die Belegungszahlen deutlich zugenommen haben.
Sehen Sie sich als Charité in so einer Phase wie jetzt als öffentliche Einrichtung, die eine Sprecherrolle für die Bundesregierung übernehmen muss? Oder sind Sie vorrangig ein Krankenhaus?
Die Charité ist ein Klinikum und eine Forschungseinrichtung – nicht mehr und nicht weniger. Wir kommunizieren auch in der Corona-Situation sehr viel zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, haben aber zusätzlich den klinischen Alltag. Das läuft dann in unserem Pandemiestab zusammen. Wenn man den von unseren Ärzten, Pflegekräften und Wissenschaftlern geschaffenen gesellschaftlichen Mehrwert kommunikativ nach außen tragen kann, ist das für mich persönlich eine echte Bereicherung.
Christian Drosten ist als Person wie kein Zweiter mit der Coronakrise assoziiert. Er ist der führende Experte für das Virus. Inwieweit beeinflusst seine Prominenz Ihre Arbeit?
Professor Drosten ist einer von über 100 Klinik- und Institutsdirektoren, die wir bei uns haben. Er ist derzeit zweifelsohne der bekannteste Wissenschaftler der Charité. Seine Stimme wird gehört. Sie ist aber auch in der Pandemie gewachsen. Anfang des Jahres kannte man ihn so noch nicht. Wir arbeiten seit Mitte Januar zusammen, als wir die Pressemitteilung zu dem Nachweisverfahren für das neuartige Coronavirus veröffentlicht haben.
Mit Blick auf China war mir damals klar, dass wir hier ein Thema haben, das uns länger beschäftigen wird. Und bei uns arbeitet ein Virologe, der diese Diskussion mit prägen wird. Wir stehen miteinander im regelmäßigen Austausch. Herr Drosten ist für unsere Kommunikationsarbeit sehr wichtig. Wir haben aber darüber hinaus etwa 20 weitere Expertinnen und Experten, die sich zu verschiedenen Schwerpunkten rund um das Virus äußern – vom Intensivmediziner bis hin zum Hygieniker oder Epidemiologen.
Haben Sie im Januar mit Herrn Drosten besprochen, was da noch kommen mag und was auf ihn zukommen könnte? Inwiefern haben Sie ihn für Medienauftritte trainiert?
Natürlich gab es von Anfang an einen Austausch und Empfehlungen. Herr Drosten besaß aber bereits Medienerfahrung. Es war insgesamt eine sehr dynamische Zeit. Wir hatten auf der einen Seite einen prominenten Virologen. Auf der anderen die gesamte interne Kommunikation für ein Universitätsklinikum mit konzernweit 18.000 Beschäftigten zu stemmen. „Intern first“ war die Devise. Wir haben uns gesagt, dass wir jetzt für eine richtig gute interne Kommunikation sorgen müssen – beispielsweise das Intranet freischalten, so dass alle Mitarbeiter im Homeoffice beziehungsweise von ihren privaten Endgeräten darauf Zugriff haben. Wir haben eine Schwerpunktseite im Intranet erstellt und Covid-Updates verfasst. Verfahrensweisen erklärt, Videobotschaften des Vorstands eingeführt, Rundmails aktiviert und einheitliche Hinweisplakate für Patienten produziert. Kurz: Wir mussten ein Klinikum auf eine Ausnahmesituation vorbereiten. Das wird rückblickend manchmal ein bisschen vergessen.
Wie arbeiten Sie mit Herrn Drosten zusammen? Wie entscheiden Sie beispielsweise, welche Interviews oder TV-Termine er wahrnimmt?
Wir tauschen uns aus. Er weiß natürlich am besten, wo er sich wohlfühlt und wo weniger. Bei den Podcasts weiß er, dass er einen Raum besitzt, in dem er komplexe Themen ausführlich erklären kann – mehr als beispielsweise in Fernsehinterviews.
Er fragt Sie aber nicht: „Frau Zingl, darf ich mal wieder einen Gastbeitrag in der ‚Zeit‘ schreiben?“
Nein. Das können Sie an einem Universitätsklinikum auch nicht erwarten. Da muss man sich eher als kommunikativer Partner sehen. Man diskutiert, lotet etwas aus.
Wie offen sind Ihre Professorinnen und Professoren für Öffentlichkeitsarbeit? Christian Drosten hat auf dem Kommunikationskongress gesagt, dass Präsenz in den Medien einen wissenschaftlich nicht weiterbringt.
Es ist ein Generationenthema. Ich denke, dass sich insbesondere die jüngeren Wissenschaftler bewusst sind, dass Öffentlichkeitsarbeit dazugehört. Dazu zählen auch Social Media. Der Wert der Kommunikation wird anerkannt. Dazu gehört aber auch eine Transferleistung. Man kann wissenschaftliche Erkenntnisse oft nicht eins zu eins übertragen. Es bedarf dann eines Kommunikators, der die wissenschaftlichen Erkenntnisse laienverständlich übersetzt. Einige Professoren wiederum möchten in den Medien nicht vorkommen. Das muss man respektieren.
Inwieweit ist es für Sie noch möglich, einem strategischen Kommunikationsfahrplan zu folgen?
Die Covid-19-Pandemie hat klar die Medienagenda dominiert. Wir haben das nicht nur reaktiv angenommen, sondern versuchen, hier aktiv und regelmäßig unsere Themen zu setzen. Zu Beginn haben wir mit großem Medieninteresse eine Untersuchungsstelle für Verdachtsfälle am Campus Virchow-Klinikum etabliert – es war Anfang März die erste in Berlin. Danach entwickelten wir eine Corona-App („CovApp“), was wir erneut breit kommuniziert haben. In einer Pressekonferenz im Roten Rathaus stellten wir dann unsere Ergebnisse der Prävalenz-Studie von Mitarbeitern vor. Wir verfassten das Konzept der Berliner Teststrategie, die wir dann wiederum aktiv kommuniziert haben. Und zuletzt haben wir in der Bundespressekonferenz auf den Mangel an Intensivpflegepersonal in Krankenhäusern hingewiesen. All diese Themen wurden medial aufgegriffen und haben anschließend die Diskussion weit über die Grenzen Berlins hinaus mitgeprägt. Somit kann man schon sagen, dass wir aktiv Punkte gesetzt haben.
Themen wie der Mangel an Intensivpflegern sind für die Charité nicht unproblematisch. Sie verdeutlichen, dass im deutschen Gesundheitswesen etwas schiefläuft. Am Ende wird so ein Mangel auch mit der Marke „Charité“ assoziiert. Für die Öffentlichkeit wirkt es, als hätte die Charité ein Problem.
Die Themen, die bei uns diskutiert werden, haben oft eine bundesweite Relevanz. Wir kommunizieren ehrlich und packen auch kritische Themen an. Dafür steht die Charité. Wenn wir von einer Position überzeugt sind, transportieren wir sie nach außen. Und das zahlt positiv auf unsere Reputation ein.
Welches Image hat die Charité aus Ihrer Sicht?
Wir sind ein Haus mit einer mehr als 300 Jahre langen Geschichte. Mit Blick auf Berlin nehmen wir eine gesellschaftlich relevante Rolle ein. Wir sind zum einen die soziale Charité. Die bei humanitären Krisen nicht zögert zu helfen wie in der Flüchtlingskrise, als wir die Basisversorgung für Flüchtlinge in Berlin übernommen haben. Wir sind zum anderen eine wissenschaftliche Einrichtung mit extrem klugen Köpfen. Die Charité ist heute sicher eine Marke, die eine erhöhte Aufmerksamkeit bei positiven Themen, aber eben auch bei negativen Issues erhält.
Corona ist nicht das einzige Thema, mit dem die Charité zuletzt in den Medien präsent war. Was haben Sie gedacht, als Sie hörten, dass Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach einem Giftattentat am Campus Mitte behandelt werden soll?
Ich hatte meinen ersten Urlaub in diesem Jahr und war gerade in Wien. Ab Montag war ich dann wieder zurück im Büro. (Anm.: Nawalny wurde am Samstag davor nach Deutschland gebracht.) Ich musste einmal durchschnaufen und mein Wochenenddienst begann. Es war nicht das erste Mal, dass ein prominenter Patient zu uns kommt. Und ich kann darauf vertrauen, dass es ein abgestimmtes und etabliertes Vorgehen gibt: mit den Ärzten, mit der Station, mit der Sicherheit und mit dem Vorstand. Die nächste Frage lautet dann: Wie gehen wir damit kommunikativ um?
Auf welcher Basis haben Sie entschieden, was Sie zu Nawalny kommunizieren?
Bei uns gab es die Überlegung, ob wir Pressestatements abgeben und vor die Kamera gehen oder – und so haben wir uns entschieden – ob wir mit Rücksicht auf den Patienten zurückhaltender agieren. Wir haben über vier Wochen schriftliche Pressestatements herausgegeben, wenn neue Erkenntnisse vorlagen oder sich der Gesundheitszustand verändert hat. Diese Kommunikationslinie haben wir bis zum Ende so durchgezogen. Jeden Journalisten, der sich bei uns gemeldet hat, haben wir mit den Pressestatements bedient. Das waren allein international 300 neue Kontakte. Journalisten hatten zwar nicht den „Bild-Moment“, den sie gerne gehabt hätten, aber sie wussten, dass wir Neuigkeiten über diesen Weg kommunizieren würden. Die Journalisten haben sich dadurch mitgenommen gefühlt. Zudem habe ich in meiner beruflichen Laufbahn noch nie so viel via SMS oder WhatsApp kommuniziert.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Der Kreml-Kritiker Alexey Nawalny war nach einem Giftattentat an der Charité behandelt worden.
Nawalny lag im künstlichen Koma, war also nicht ansprechbar und konnte nicht entscheiden, was über seinen Gesundheitszustand nach außen dringt. Nur weil jemand prominent ist, wird die ärztliche Schweigepflicht nicht aufgehoben. Was darf ein Krankenhaus in so einer Situation kommunizieren?
Grundsätzlich gar nichts. Es erfolgt immer eine individuelle Rücksprache mit dem Patienten und, wenn dieser nicht ansprechbar ist, mit seinen Angehörigen. Herr Nawalny ist eine Person der Öffentlichkeit und das mediale Interesse war enorm. Bei jedem Pressestatement – das haben wir so auch immer geschrieben – haben wir uns mit seiner Frau rückgekoppelt. Wenn die Familie gesagt hätte, dass wir nichts sagen sollen, hätten wir auch nichts gesagt. Darauf können sich unsere Patienten, ob nun prominent oder nicht, absolut verlassen.
Auch die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und Pussy-Riot-Aktivist Pjotr Wersilow wurden bei Ihnen behandelt. Inwieweit ist es für die Charité positiv, dass sie in einem hochpolitischen Kontext erwähnt wird?
Unsere Aufgabe ist, den Patienten zu behandeln. Alles andere, was drum herum stattfindet, hat für uns keine Relevanz. Unsere Öffentlichkeitsarbeit beginnt, wenn der Patient bei uns ankommt und die Ärzte einen ersten Eindruck vom Gesundheitszustand haben. Um Sachlichkeit im Fall von Herrn Nawalny reinzubekommen, haben wir uns für eine schriftliche Form der Kommunikation entschieden und beispielsweise keine Pressekonferenz mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten gemacht.
Welche Strategie verfolgen Sie in den Social Media? Welche Informationen wollen Sie vermitteln? Auf Twitter war beispielweise vor kurzem ein Foto von Jens Spahn zu sehen, der sich gegen Grippe impfen lässt.
Twitter ist für uns klar der Nachrichtenkanal. Es muss eine News dahinterstehen. Das sind vor allem wissenschaftliche Ergebnisse in Kombination mit unseren wissenschaftlichen Pressemitteilungen. Zu Nawalny haben wir unsere Pressestatements dort ebenfalls auf Deutsch und Englisch verbreitet. Auf Instagram versuchen wir unter anderem Medizinstudierende und Auszubildende zu erreichen. In den Take-overs geben wir Einblicke in die Arbeit auf den Stationen und begleiten die Teams. Wir versuchen die Arbeitgebermarke Charité damit zu stärken. Wir zeigen, wie es ist, an der Charité zu arbeiten. Facebook ist eine Mischung. Es ist auch der Kanal, der von unseren Pflegekräften wohl am stärksten genutzt wird.
Fake News und Spekulationen sind in den Sozialen Netzwerken weit verbreitet. Inwieweit gehen Sie dagegen vor?
Wir haben ein umfangreiches Monitoring. Wir reagieren aber nicht auf jeden Kommentar. Wir greifen dann ein, wenn über die Charité selbst etwas Falsches veröffentlicht wird. Manchmal weisen uns aber auch Journalisten auf Falschmeldungen hin, indem sie sich rückversichern, ob da etwas dran ist.
Wie organisieren Sie Ihr Team während der Coronakrise?
Im Sommer waren wir im Büro präsent. Aktuell sind wir aufgrund der steigenden Fallzahlen wieder alle im Homeoffice. Wir nutzen Microsoft Teams für die interne Kommunikation. Jeden Montag haben wir eine Redaktionssitzung, in der wir besprechen, was die Themen der Woche sind und welche Termine anstehen. Die Themen spielen wir dann durch für die Schwerpunkte, die wir haben: Pressearbeit, Wissenschaftskommunikation, interne Kommunikation und Social Media. Mit dabei sind auch mein Veranstaltungs- und Web-Team sowie eine Mitarbeiterin, die für Corporate Publishing verantwortlich ist. Einmal am Tag tausche ich mich mit dem redaktionell arbeitenden Teil des Teams aus – das ist etwa die Hälfte meiner Mitarbeiter. Es ist wichtig, mit allen den Kontakt zu halten – auch aus der Ferne.
Wie definieren Sie Ihre eigene Rolle?
Ich bin für die Kommunikation der Charité als Ganzes verantwortlich. Das heißt zunächst, dass ich den Überblick über die vielfältigen Charité-Themen im Blick behalte und eine professionelle Kommunikation dazu sicherstelle. Das beinhaltet, dass ich mit den Vorstandsmitgliedern unternehmenspolitisch relevante Themen bearbeite und auch die Klinik- und Institutsdirektoren berate. Auch sie brauchen ein offenes Ohr, wenn kommunikative Beratung oder Unterstützung nötig ist. Darüber hinaus bin ich selbst die zentrale Sprecherin für unternehmenspolitisch und strategisch wichtige Themen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe DIVERSITY. Das Heft können Sie hier bestellen.