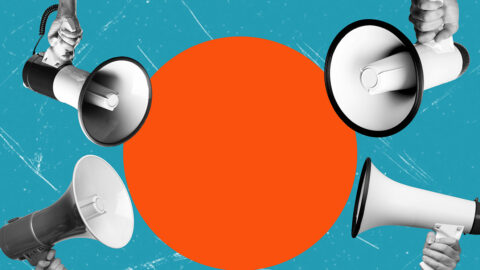Claudia Oeking leitet bei Philip Morris in Deutschland den Geschäftsbereich External Affairs, was unter anderem die Unternehmens- und Wissenschaftskommunikation, die Hauptstadtrepräsentanz, Public Relations, Corporate Social Responsibility sowie Fachbereiche zur Regulierung und Besteuerung umfasst. Die 39-Jährige ist seit 2013 für den Tabakkonzern tätig. Vorher war sie bei EnBW für die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Als Beirätin engagiert sich Oeking für das von der ehemaligen Ketchum-Pleon-Chefin Victoria Wagner gegründete Netzwerk „Beyond Gender Agenda“, das sich für Diversity und Chancengleichheit einsetzt.
Frau Oeking, Sie sind Geschäftsführerin für den Bereich External Affairs bei Philip Morris in Deutschland. Inwieweit sehen Sie sich als Role Model für eine beruflich erfolgreiche Frau?
Claudia Oeking: Ich habe das nie so gesehen, weil ich nie geplant hatte, wo ich jetzt gelandet bin. Mir ging es darum, das zu machen, was mir Spaß macht, und etwas zu finden, in dem ich gut war. Mit Journalismus habe ich angefangen. Da war ich schlecht aufgehoben. Wenn man nicht das Gefühl dafür hat, kritischen Themen nachzugehen, was den Journalisten ausmacht, dann ist vielleicht die Kommunikationsseite die richtige.
Als ich in der Kernkraft bei EnBW war und eine Führungsaufgabe bekam, meinte zum ersten Mal jemand, das sei toll. Ich sei ein Vorbild. Damals hatte ich das nicht verstanden, weil ich mir der Problematik von Ungleichheiten nicht bewusst war. Heute ist mir klar, dass ich immer viel Glück hatte und von Männern und Frauen gefördert wurde. Andere erleben aber Benachteiligungen. Wenn diese Personen in mir jemanden sehen, bei dem sie Orientierung finden, freut mich das.
Im Dax gibt es nach Jennifer Morgans Abschied bei SAP wieder keine einzige Frau als CEO. Auch die leitenden Positionen in der Kommunikation von namhaften Konzernen und Agenturen sind überwiegend von Männern besetzt. Was lief bei Ihnen anders?
Ich habe konsequent das gemacht, worin ich gut bin. Spätestens bei EnBW habe ich gemerkt, dass ich am besten an der Schnittstelle funktioniere, an der Menschen Ängste haben, Themen kontrovers sind und ein Unternehmen verstehen möchte, was draußen passiert. Für eine Firma, die ihren Schuh durchzieht und wenig auf die Meinung von Gesellschaft und Medien eingehen muss oder es nicht möchte, wäre ich ungeeignet. Eine reine Sendefunktion liegt mir nicht. Produkt-PR wäre ebenfalls nicht meins. Ich habe meine Nische gefunden – auch wegen der Schnittstelle zur Politik. Weil ich mir Jobs gesucht habe, die mir Spaß machen, konnte ich darin überhaupt erst gut sein.
Als Sie Ihre ersten beruflichen Erfahrungen gemacht hatten, welches Ziel haben Sie sich da gesetzt? Wollten Sie immer schon einmal Geschäftsführerin werden?
Nein, das kam mit der Zeit. Ich hatte anfangs einen Bachelor-Abschluss. Ich habe mich dann in meiner Zeit bei der EnBW entschieden, einen MBA zu machen, weil Kollegen und Vorgesetzte mir gesagt haben, dass sie mir eine Führungsrolle zutrauen. Das wollte ich dann nicht am fehlenden Abschluss scheitern lassen. Irgendwann Kommunikationschefin zu werden, fand ich schon reizvoll. Bei Philip Morris wird man sehr schnell gefragt, was man in fünf oder zehn Jahren werden möchte. Dadurch musste ich mir die Frage stellen, was ich erreichen will.
Inwieweit halten Sie es für wichtig, sich ein Karriereziel zu setzen und dieses auch gegenüber seinen Chefs zu kommunizieren?
Die Frage ist, ob überhaupt für jeden eine Karriere erstrebenswert ist. Als Teenie war das nie mein Ziel. Wenn man Karriere machen möchte, sollte man sie explizit planen. Studien zeigen, dass eher diejenigen erfolgreich sind, die für sich einen Karriereplan entwickelt haben, als diejenigen, die das nicht gemacht haben. Karriere nur der Macht oder des Titels wegen machen zu wollen, fliegt irgendwann auf. Zur Karriere gehört für mich, Verantwortung zu übernehmen – beispielsweise für ein Team. Das muss man sich bewusstmachen.
An welchen Stellen in Ihrer bisherigen Karriere hat es eine Rolle gespielt, dass Sie eine Frau sind? Hatten Sie dadurch jemals Nachteile?
Ich konnte mich in Unternehmen entwickeln, in denen das Geschlecht entweder keine Rolle gespielt hat oder sich die Firma bewusstgemacht hat, dass es in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat und man etwas ändern muss. Wir sind alle nicht frei von Emotionen und Vorurteilen. Das muss man sich immer klarmachen. Das beginnt damit, dass man zum Beispiel zu bestimmten Terminen eher einen Mann und zu anderen eine Frau hinschickt.
Wie ist die Unternehmenskultur von Philip Morris, einem Unternehmen, das wie kein anderes mit Tabak und Zigaretten verbunden ist?
Im Konzern wollen die meisten Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kulturen und international arbeiten. In der Vergangenheit haben wir das Thema Diversity sicher nicht richtig erkannt. Im letzten Jahrzehnt haben wir gesehen, dass es an dieser Stelle Nachholbedarf gibt.
Wir sind das Thema zuerst mittelprächtig angegangen. Jetzt aber ernsthaft, weil wir festgestellt haben, dass wir in einer komplexen Welt auf keinen Gedanken verzichten können. Wir müssen weibliche Perspektiven und unterschiedliche Kulturen einbringen. Wir müssen sicherstellen, dass wir inklusiv sind, etwa im Miteinander mit People of Colour, und uns überlegen, wie wir den LGBTQ-Gedanken berücksichtigen. Wir sind hier aktiv geworden, weil wir glauben, dass wir dann bessere Entscheidungen treffen und erfolgreicher sind. Für viele meiner Kollegen und mich ganz persönlich ist das aber vor allem eine Herzensangelegenheit.
Und in Deutschland?
Hier sind wir weiterhin eine Organisation mit vielen Kollegen aus Deutschland. Wir schauen aber verstärkt, dass wir Menschen aus aller Welt dazu holen und Frauen auf allen Hierarchieebenen fördern. Wir schauen auf jeder Ebene und in jeder Gehaltsstufe, wie viele Frauen dort tätig sind. Werden sie ausgebremst? Warum? Ist das eine Frage von Teilzeit? Wo können wir Prozesse und Arbeitsbedingungen so verbessern, dass Chancengleichheit gegeben ist?
Was sind bei Ihnen Hürden, dass Frauen nicht nach oben kommen? Das Argument, es liegt daran, weil Frauen sich stärker um die Kindererziehung kümmern, zieht nur bedingt, weil Frauen ohne Kinder Führungspositionen ebenfalls kaum erreichen.
Sie haben Recht: Die Lebensumstände können es nicht alleine sein. Das Thema Netzwerke spielt sicher eine Rolle, da Personen bevorzugt diejenigen befördern, die ihnen nahestehen. Da haben Männer typischerweise Männer befördert. Das konnte man bei uns auch sehen. Es stellt sich zudem die Frage, ob es die Geschäftswelt mit ihren traditionellen Abläufen und ihrem Machismo Frauen in der Vergangenheit fast unmöglich oder auch nicht besonders reizvoll gemacht hat, zu partizipieren. An all diesen Punkten setzen unsere Maßnahmen an. Die Generation Y dürfte uns hier auch weiterbringen, weil sie insgesamt auf 24/7 keine Lust mehr hat und mal abschalten möchte von der Arbeit.
In Kommunikationsberufen sind beim Einstieg rund 70 Prozent der Personen weiblich. Ist es nicht trostlos, dass es in einer Branche wie der Kommunikation, die sich betont offen gibt, nur wenigen Frauen gelingt, in Führungspositionen aufzusteigen?
Ja. Es ist trostlos. Im kreativen Bereich ist es sogar noch schlimmer, was umso unverständlicher ist, weil es für Kreativität so wichtig ist, dass sie aus verschiedenen Perspektiven gedacht wird. Wie wollen uns Kreative die Zukunft aufzeigen, wenn sie diese gar nicht aus allen Perspektiven beleuchten können? Bei Agenturen ist es ähnlich, wie auch in der Verlagsbranche, wo es höchstens ein oder zwei Vorzeigefrauen gibt. Wir Frauen müssen schauen, wie wir uns besser stützen können. Dass wir eben vorkommen.
Weshalb zeigt sich die Unternehmenskommunikation so wenig progressiv?
Ein branchenspezifischer Grund ist, dass in der Unternehmenskommunikation der Job leider häufig außerhalb der Geschäftszeiten stattfindet. Eine Krise kommt gerne am Freitagnachmittag. Wenn es in der Rollenverteilung so ist, dass Frauen sich stärker um die Familie kümmern, werden sie ausgeschlossen, weil sie bestimmte interessante Aufgaben nicht übernehmen können. Wir müssen deshalb die Prozesse so aufstellen, dass niemand aufgrund des Familienalltags von den heißen Themen ausgespart wird.
Wie sieht Ihr optimales Team aus?
In einem optimalen Team muss man die Geschlechter und unterschiedlichen Altersstrukturen abbilden und Menschen mit verschiedener Herkunft und verschiedenen Denkmustern einstellen. Spannend wird es beim Thema LGBTQ, weil sicher nicht jeder will, dass die eigene sexuelle Orientierung bekannt wird. Auch müssen wir Menschen mit Handicap repräsentieren. Bei mir im Team ist zudem Diversität in der politischen Einstellung relevant. Habe ich im demokratischen Spektrum alle Bereiche abgedeckt? Das heißt, auch grüne und NGO-Ansichten zu berücksichtigen und entsprechende Leute in der Abteilung zu haben.
Auf Personen mit einer linken oder grünen Orientierung wirken Konzernstrukturen oft wenig attraktiv. Philip Morris wäre nicht das Unternehmen, wo sie den CV hinschicken würden.
Das stimmt. Aber wir geben nicht auf. Es ist ja für uns alle so. Jeder muss für sich abgeklopft haben, ob er das Unternehmen, für das er arbeitet, repräsentieren kann und ob das Unternehmen seine Werte vertritt. Hier gibt es den Eindruck von außen wie bei mir damals beim Einstieg in die Kernkraft oder dem Start bei Philip Morris und die Perspektive von innen.
Was können Unternehmen machen, dass Diversity mehr gefördert wird und Frauen bessere Chancen bekommen?
Unternehmen müssen es ermöglichen, dass es neben der Arbeit ein Privatleben geben kann. Sie müssen Familienfreundlichkeit gewährleisten. Teilzeitmodelle dürfen kein Jobkiller sein. Wir müssen uns in Firmen die Kennzahlen genau anschauen, um zu erkennen, wo systemische Fehler vorliegen. Außerdem gilt es, Vorurteile abzubauen. Aktuell reden wir viel von People of Colour. Da stellt sich die Frage, ob wir integrativ genug sind – auch gegenüber denjenigen, deren Familien vielleicht vor zwei oder drei Generationen nach Deutschland gekommen sind.
Wie kann die Kommunikation dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut werden?
Hier sind sicherlich die Kollegen aus dem Personalbereich die Treiber. Wir können sie in der internen Kommunikation unterstützen, um das Change-Management voranzutreiben. Das heißt unter anderem aufzuzeigen, dass Chancengleichheit und Diversity für den Zukunftsweg und Erfolg einer Firma essenziell sind. Wir eben alle Perspektiven brauchen und die Gesellschaft die Erwartung an uns hat, auch zu kritischen Fragestellungen Antworten parat zu haben und Lösungen aufzuzeigen. Beides ist zum Wohle des Unternehmens.
Das ist eine sehr rationale Herangehensweise. Könnte man nicht auch Leute dadurch ansprechen, dass man ihnen vermittelt, es mache einfach mehr Spaß, in Teams zu arbeiten, die nicht homogen zusammengesetzt sind?
Wenn das für Sie so belegt ist, ist es gut. Andererseits muss man sich bewusst sein, dass Diversität erst einmal Reibungen verursachen kann: Homogene Gruppen denken nun mal ähnlich und finden daher schneller einen Konsens. Deswegen muss man weiterhin rational erklären, dass diverse Teams deutlich bessere Lösungen finden und dass am Ende des Tages das Unternehmen so erfolgreicher sein wird.
Müssen CEOs vorangehen und Chancengleichheit und Diversity zu einer Herzensangelegenheit machen?
Ja. Wenn der CEO es nicht macht, kann man das Thema im Unternehmen vergessen. Es ist etwas, das von oben gelebt werden muss – wie alle Change-Themen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe TÖNNIES. Das Heft können Sie hier bestellen.