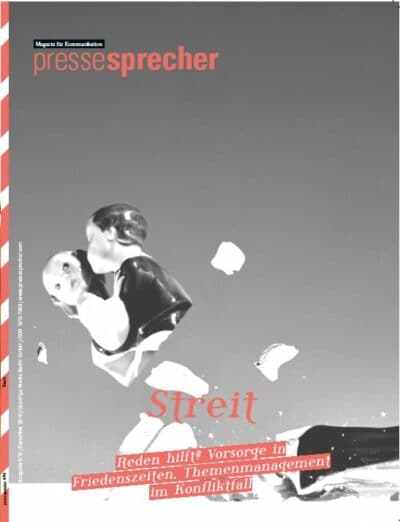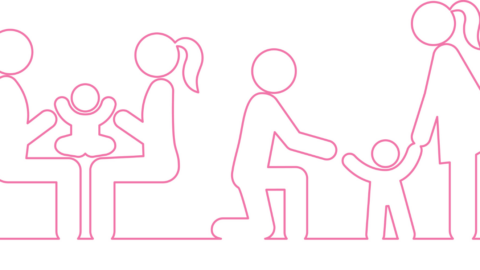Vor dem Interview ließ Tom Schmitt unser Team erstmal auf dem Flur warten, im Gespräch trug er dann unter dem Tisch Puschen. Uns ließ der Coach teilhaben am unausweichlichen Statusspiel, dem Gerangel um die Rangordnung, der Freude am Gewinnen und erklärt, warum „Männer gockeln und Frauen kullern“. Am Ende stand es unentschieden, ließ er uns hoffen. Aber lesen Sie selbst…
Herr Schmitt, welchen Status lesen Sie an mir gerade ab?
Tom Schmitt: Gar keinen, weil Sie relativ entspannt vor mir sitzen. Status sieht man vor allem in sozialen Stresssituationen. Dann senden wir körpersprachliche Signale aus, die bei den allermeisten auf einen tieferen Status hinweisen würden.
Wir schauen bei der Betrachtung unseres Gegenübers zuerst auf das Äußere. Kann ich mir einen Hochstatus kaufen durch eine teure Uhr oder einen edlen Anzug?
Ja klar, Kleider machen Leute. Aber teuer ist nicht immer gut, es gibt auch jede Menge schlechten Stil. Ich nenne solche Dinge wie auch Autos oder Handtaschen Statusheber: Wir geben sehr viel Geld aus, um etwas für unseren Status zu tun. Das zeigt mir, wie wichtig Status für uns ist.
Haben Sie heute Morgen überlegt, was Sie anziehen?
Natürlich. Die Alternative zum Sakko wäre ein aufgepopptes Armeejacket gewesen. In Seminaren mache ich das gern und spiele bewusst mit dem Außen. Ich trage auch seit drei oder vier Jahren grundsätzlich keine Krawatte mehr.
Tragen Sie eine Edeluhr?
Nein, mir reicht als Statusheber meine Brille, die ist ein Einzelstück aus Holz. Aber Ihre Uhr ist ganz schön.
Danke. Gerade wollte ich Wasser für alle nachschenken. In manchen Meetings tue ich das extra für die Harmonie, in anderen würde ich es auf Teufel komm raus niemals tun. Stecke ich schon mitten im Statusspiel?
Ja. Wären Sie in einer sozialen Stresssituation, hätten Sie eine klare Statuspräferenz, die unweigerlich zum Vorschein käme. Bei den meisten ist das der tiefere Status, denn es ist ihnen wichtiger, sympathisch zu wirken und gemocht zu werden, als sich durchzusetzen.
Wir machen uns also gern klein?
In Stresssituationen: Ja.
Ist das typisch deutsch?
Nein, das ist das Wesen des Menschen. In der Urhorde ist es schlauer, wenn die anderen dich mögen. Dann stehst du eher in der Mitte als am Rand. Das ist tendenziell sicherer.
Passt dazu die Lächelfalle?
Ja, sie steht für eine Art von vorauseilendem Gehorsam. Als auf der Betriebsfeier meiner Frau gestern eine sonst sehr patente Kollegin das Buffet eröffnete, hatte sie plötzlich nur noch ein Dauergrinsen, ihre Stimme ging hoch, und all das strahlte das Gegenteil von Kompetenz aus.
Schließen sich Nettsein und Kompetenz aus?
Nicht unbedingt. Aber Nettsein ist in der Wahrnehmung nun mal eher mit dem tieferen Status, Kompetenz aber sehr stark mit dem höheren Status verknüpft.
Wenn Status im Leben so entscheidend ist: Geht es im Leben immer ums Gewinnen?
Das kommt darauf an, was man persönlich als Gewinnen definiert. Wenn es mir darum geht, immer der Erste zu sein im Sinne von „first don´t follow“ – dann schon. Für mich ist das ein unmenschliches Prinzip, weil immer nur einer der Gewinner sein kann. Ich definiere unter Gewinnen meine innere Haltung, meine Ziele erreichen zu wollen. Wenn das stattfindet, dann folgt alles andere, denn ich bin innerlich entschieden und jede Handlung folgt dieser inneren Entschiedenheit.
Viele Menschen wollen gar nicht die Oberhand gewinnen.
Klar, wenn ich mein Ziel auch erreichen kann, indem ich mich kleinmache, ist das doch gut. Das ist wie die erlernte Hilflosigkeit: Wenn ich dauernd sage, „ich kann das nicht“, dann macht es jemand anderes. Kinder können das sehr gut.
Was ist denn Ihr KPI für Gewinn?
Im reiferen Alter will ich nicht mehr unbedingt der Tollste sein, sondern habe andere persönliche Ziele. Mir geht es eher darum, ein Maß innerer Zufriedenheit und Erfülltheit zu finden. Dann kann Gewinnen auch bedeuten, allein an der Elbe spazieren zu gehen.
Tom Schmitt (c) Oliver Fantitsch
Warum ist eine Rangordnung überhaupt so wichtig für Unternehmen und Organisationen?
Darüber kann man sich wunderbar streiten, weil es viel mit dem Tabuthema Macht zu tun hat: Diejenigen, die sie haben, reden nicht gerne drüber und die, die sie nicht haben, wissen nicht, worüber sie sprechen. Ich habe oft den Eindruck, dass die Mächtigen nicht zugeben wollen, wie geil sie das in Wahrheit finden. In einem Buch voller CEO-Interviews sagen die alle, dass ihnen Macht nicht wichtig sei. Ich glaube, die betuppen sich selbst.
Der Primatenforscher Robert M. Sapolsky hat mit Hilfe von Bluttests bei Affen herausgefunden, dass auch in Pavianhorden das mittlere Management den größten Stress hat. Das Alphatier im Hochstatus ist entspannt und es gibt auch in dieser Horde Politik: Selbst wenn der Alpha alt und gebrechlich wird, sorgen die Weibchen dafür, dass er an der Spitze bleibt, weil sie es unter ihm gut haben. Und umgekehrt wird ein despotischer Alpha kollektiv weggebissen – was einem Todesurteil gleichkommt, weil er ohne eine Horde kaum Überlebenschancen hat.
Also ist eine Rangfolge überlebensnotwendig für Gesellschaften?
Ja. Wenn wir uns mal kurz von der Idee des Menschen als Krone der Schöpfung verabschieden und das Kollektiv als einen Organismus sehen, dann ist die Horde überlebensfähiger, sobald es Hierarchie gibt. Bei zehn Personen hat man ohne Hierarchie 45 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, mit einer Hierarchie sind es nur noch neun, die Kommunikation ist dann also viel effizienter.
Sie waren früher Schauspieler und Regisseur. Wie waren da Ihre Erfahrungen mit Hierarchien?
Ich war in einem Theaterkollektiv, und das war grausam: Alle waren gleich, aber ein paar waren gleicher.
Waren Sie einer der Gleicheren?
Nein.
Hat es Ihnen gefallen?
Wir haben dauernd diskutiert, das dauerte alles ewig. Und wenn die Gruppe entschied, wir gehen in diese Richtung, dann gab es immer welche, die außenrum gingen und riefen: „Mir nach!“ Das waren die Politiker in der Theatergruppe. Gute Politiker können das: Sie spüren, wohin sich eine Gruppe bewegt, und gerieren sich im entscheidenden Moment als Anführer. Da geht es nicht um Inhalte, ,sondern um Positionen.
Ist dieses Gerangel also unausweichlich?
Ja, und zwar immer sobald zwei oder mehr Menschen zusammenkommen. Das ist systemimmanent. Das hat aber nichts mit der Hackordnung oder der Hühnerleiter zu tun. Im Gegenteil: Wir alle bewegen uns tagtäglich in den unterschiedlichsten sozialen Gruppen und nehmen in jeder dieser Gruppen einen anderen Status ein. So kann jemand, der im Job einen Tiefstatus hat, in seiner Freizeit Jugendfußball trainieren und dort das Sagen haben. Genau das sind die Ressourcen, aus denen man schöpfen kann, wenn man an seinem Status arbeiten will.
Wie passen diese Ideen der festen Gefüge in Zeiten von Agilität und Disruption mit verschwindenden Abteilungsgrenzen?
Immer weniger. Formell schafft man Hierarchien ab, aber informell bilden sich innerhalb der Organisation neue, die weniger leicht zu durchschauen sind.
Dann muss ich also am Tag dutzendfach mein inneres Kostüm wechseln?
Ja, das kann passieren.
Das kann überfordern. Und viele Menschen wünschen sich einen eigenen Platz.
Darum fahren sie ja im Urlaub auch immer an denselben Ort, wenn es sein muss.
Sie auch?
Nein. (Lacht). Ich glaube, dass wir immer und überall Rollen spielen. Wenn ich das, was ich tue, als Rolle verstehe, dann kann ich diese Rolle bewusst gestalten. Sie erwarten von mir, dass ich Ihrer Erwartung eines Interviewten entspreche, privat bin ich aber vielleicht ganz anders. Ich verstehe alles, was ich tue, als eine Rolle, in der ich authentisch agieren kann. So bekomme ich Handlungskompetenz.
Tom Schmitt im Interview mit pressesprecher-Chefredakteurin Hilkka Zebothsen (c) Oliver Fantitsch
Dabei unterscheiden Sie Status im Innen und Außen.
Was zählt, ist die innere Entschiedenheit. Das ist wie der Grashalm, der sich bei Sturm legt und später wieder aufrichtet, weil er feste Wurzeln hat: Er hat einen äußeren Tief- und einen inneren Hochstatus. Doppelter Hochstatus wäre die Eiche: Sie steht wie eine Eins, aber wenn sie einmal gefallen ist, dann wars das dann auch.
Haben Sie ein menschliches Beispiel für den Status „innen hoch, außen tief“?
Der Fußballtrainer Pep Guardiola fummelt sich bei Interviews nach dem Spiel gerne und oft am Kopf herum. Das ist ein klares Tiefstatussignal, kann aber auch Absicht sein, um unterschätzt zu werden, denn ich glaube schon, dass er weiß, wovon er redet. Oder der Sprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins: Wenn der vor einer Gruppe Reportern steht, legt er beim Zuhören den Kopf leicht schief und zeigt so den Tiefstatus, dabei hat er großes inneres Standing. Jeder Status hat einen Benefit. Und einen Preis.
Haben Sie ein Beispiel für einen doppelten Hochstatustypen?
Doktor Michael Otto: Bei ihm passen Manieren und Aussehen, der ist sehr hanseatisch zurückhaltend, ein feiner Herr. Und er weiß genau, was er will. Oder Daimler-Boss Dieter Zetsche. Klarer Fokus, er hat den Konzern wirklich nach vorne gebracht. Normalerweise würde man sagen, er müsste dringend mal den Bart abnehmen, aber bei ihm ist das authentisch.
Wie erkennen Sie die Statusdynamik in einem Unternehmen?
Zum Beispiel indem ich frage: „Können Sie Ihren Chef loben?“ Je nachdem wie die Antwort ausfällt, weiß ich, wie die Abteilung tickt. Sagt der Mitarbeiter: „Ja, kann ich“, dann schließt das auf ein eher kollegiales Verhältnis. Er sagt auf der Sachebene: „Das hast du gut gemacht“, und auf der Beziehungsebene: „Ich habe die Kompetenz, das zu beurteilen.“
Sagt der Mitarbeiter aber: „Um Gottes willen, nein“, dann herrscht hier eine eher stark hierarchische Struktur, in der das Lob für den Chef als Anmaßung und Statusverletzung erlebt wird.
Verhandeln Sie Status auch im Privaten?
Dauernd. Ein Beispiel: Ich zog vor vielen Jahren nach Hamburg-Blankenese, das ist die Zentrale der Statusspiele. (lacht) Unten am Elbstrand gibt es einen schmalen Betonweg, auf dem man leichter spazieren geht als im Sand. Meine Exfreundin und ich sind gut erzogen und standen also dauernd im Sand oder auf der Kante, wenn die Herrschaften uns entgegenkamen. Irgendwann wich ich extra nicht aus. Die Folge waren Dauerrempler. Erst als ich den Entgegenkommenden ignorierte und nicht ansah, konnte ich unbehelligt über den Betonweg pflügen.
Ist Status immer ein Wechselspiel?
Ja. Sogar Muskelspannung, Atem- und Herzfrequenz übertragen sich. Darum hat Mozart viele ruhige Sonaten genau auf 60 Schläge in der Minute komponiert, das entspricht unserem Herzrhythmus in der Entspannung. Wenn Mozart in anderen Stücken auf 92 ging, wusste er genau, was er tat. Das kennt man auch vor der Bühne: Wenn der Referent einen Puls von 110 hat, geht ein Publikum innerlich mit und der Herzschlag der Zuhörer beschleunigt sich. Gleichzeitig sitzen Sie aber ruhig im Stuhl. Das passt nicht zusammen, irritiert und führt zu einem gewissen Unwohlsein, die Kompetenz des Referenten leidet.
Spielen Männer Status anders als Frauen?
Klar, eine weibliche Führungskraft sagte mir mal, dass Männer gockeln und Frauen kullern.
Hilft kullern im Streit?
Das kommt auf Ihre Strategie an, aber wenn Sie einen Strafzettel bekommen sollen, hilft kullern sicher mehr als ein Infight.
Hilft kullern auch Kerlen?
Eindeutig. Als ich mit meinem Sohn im Leihwagen im Yosemite-Nationalpark unerlaubt ein Wohnmobil überholte und uns der Ranger rauswinkte, habe ich auf Teufel komm raus gekullert, weil man sich in den USA besser nicht mit Ordnungshütern anlegt. Also warf ich mich kommunikativ in den Staub, entschuldigte mich wortreich für mein Verhalten und beteuerte: „I love this country.“
Andersherum habe ich auf der Elbchaussee mal einen Streifenwagen angehupt, der beim Abbiegen aus einer Seitenstraße halb in meiner Fahrbahn stand. Er kam mit Blaulicht hinterher, wollte Papiere, Verbandskasten, Warndreieck sehen. Ich fragte nur ruhig nach seiner Dienstnummer statt seinem Namen, da hielt er mich für jemanden, der Bescheid weiß, bekam kalte Füße und ließ mich weiterfahren. Innerer Status plus Klarheit im Außen, fertig.
Zur Not hilft vermutlich nur Charisma. Was macht das für Sie aus?
Charisma ist schwer fassbar, aber hat sieben verstärkende Faktoren: Eine Person mit Charisma verfügt über Selbstwert. Angstfreiheit. Und Statusintelligenz, das heißt, sie kann mit dem Status spielen wie gute Verkäufer, Führungskräfte oder Kommunikatoren. Wer als Führungskraft bewusst mit dem Status zu spielen versteht, kann beruflichen Erfolg nicht mehr verhindern. Und Sie müssen es verstehen, die eigene Rolle zu inszenieren.
Zu Charisma gehört ein höheres Ziel, das größer ist als Ihr Ego. Sie brauchen außerdem Demut. Und Sie brauchen die Erfahrung einer Heldenreise, Sie müssen schon etwas erlebt und Narben haben. Nehmen Sie das Beispiel Christian Wulff: Als er Bundespräsident wurde, wirkte er glatt ohne Ecken und Kanten, nicht als eine Person, die schon mit vielen Widrigkeiten des Lebens fertig wurde. Darum konnte ihn die Bild auch wegen eines BobbyCars abschießen. Gauck hat da ein ganz anderes Standing.
Kann ich Charisma lernen?
Ja, unbedingt.
Beruhigend. Nach zwei Stunden zwischen Hoch- und Tiefstatus: Wer von uns hat nun gewonnen?
Wir beide. Sie an Wissen, ich an Status.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Streit. Das Heft können Sie hier bestellen.