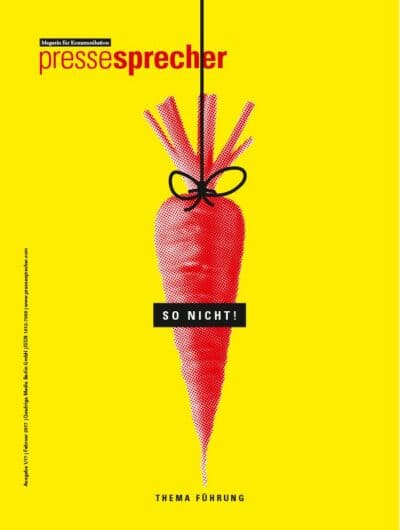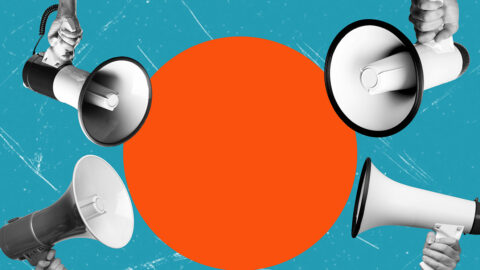Frau Pott, immer mehr Unternehmen werden in ihrem Selbstverständnis zu Verlagen. Auch Ihre Initiative wird von Newsroom zu Newsroom kommuniziert. Brauchen Sie mich überhaupt noch als Journalistin?
Ulrike Pott: Wir brauchen auch in Zukunft die Medien, aber erstellen immer mehr Content selbst und distribuieren ihn auch. Auf dem Tisch liegen Zeitungen mit Clippings zu unserer Initiative, auf die wir sehr stolz sind. Aber unsere eigenen Kanäle werden wichtiger.
Medien haben heute eine andere Rolle: Früher war ich als Reporterin auf der Straße unterwegs, um zu zeigen, was ist. Heute bin ich eher Kuratorin und ordne Themen ein in ihrer Flut.
Alexander Lang: Wir verstehen Medien als einen Kanal von vielen für unseren Content. Aber natürlich braucht es nicht nur im politischen Berlin den Journalisten, der den Content prüft, aufbereitet und verarbeitet. Wir machen zum Beispiel keine Advertorials, die helfen niemandem. Ein als Anzeige gekennzeichneter Inhalt hat nicht das Gütesiegel der Glaubwürdigkeit, es braucht eben nicht nur das Papier oder die Webseite für Inhalte, sondern auch deren Prüfung.
Wir bezahlen nicht dafür, dass unser Content gedruckt wird, und wir machen keinen Lobbyismus, bearbeiten niemanden. Wir machen Umfragen, Studien und bieten faktenbasierten Content an oder helfen, den zu finden. Aber nicht mehr. Uns würde es nicht helfen, wenn Journalisten kritisch reagieren, weil sie zum 17. Mal vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft angerufen werden, bloß weil ihnen jemand was zum längeren Leben erzählen will.
Dennis Schmidt-Bordemann: Unsere Prozesse sind ganz ähnlich wie in der klassischen Redaktionsarbeit, aber wir verstehen uns als Think Tank. Wir leuchten eigene und fremde Daten aus, machen zum Beispiel Sonderauswertungen auf regionaler Ebene und setzen eigene Akzente in der Debatte.
Und was wäre für Sie ein messbarer Erfolg?
Pott: Anders als bei anderen Kampagnen definieren wir bei dieser Initiative Erfolg nicht über den Produktverkauf, die Anzahl der Namensnennungen oder des Claims. Wir wollen bewusst keine werblichen Botschaften transportieren. Uns geht es um das Thema an sich, da ist es auch ein Erfolg, wenn andere es aufnehmen und weiterdrehen.
Auf der Webseite steht unter „Zielen“, dass Sie den gesellschaftlichen Dialog zum Altern anstoßen wollen. Sie möchten aber schon auch Versicherungen verkaufen, oder?
Pott: Ja, natürlich. Unsere Mitgliedsunternehmen sind Anbieter von Lebensversicherungen, dem in Deutschland immer noch wichtigsten Produkt für die zusätzliche Altersvorsorge. Hier gibt es etwa 90 Millionen Verträge, 70 Millionen von ihnen dienen zur Altersversorgung. Dieses Produkt ist seit etwa acht Jahren durch die Niedrigzinsen unter Druck, was für uns der Anlass war, den eigentlichen USP kommunikativ in den Vordergrund zu stellen: nämlich dass Lebensversicherungen die einzigen sind, die neben der gesetzlichen Rentenversorgung eine lebenslange Rente zahlen.
Wir haben einen langen Blick zurück und kennen die Fakten zur steigenden Lebenserwartung. Vor dem Hintergrund der Finanzmarkt- und Flüchtlingskrise rückte das Thema in der Politik in den Hintergrund. Dabei wird die Demografie und Alterung die Gesellschaft umwälzen. Aber sind wir als Bevölkerung ausreichend darauf vorbereitet? Wir glauben, nicht.
Lang: Du wirst irgendwann 60 sein, aber dein 60 wird ein ganz anderes sein als das 60 deiner Eltern oder Großeltern, das aber dein Denken geprägt hat. Du möchtest lange leben, mit einer Weltreise und Fallschirmspringen am Lebensabend? Dann musst du dir das auch leisten können. Unser Job ist es, mehr als ein Grundrauschen zu schaffen, damit sich Menschen mit ihrem Alter beschäftigen.
War es schwer, die Mitglieder unter einen Hut zu bringen?
Pott: Einen gemeinsamen Nenner für mehr als 100 Unternehmen zu finden, ist nie ganz leicht und hat in diesem Fall etwa anderthalb Jahre gedauert.
Und das kommunikative Dach kam dann von der Agentur?
Pott: Nein, den USP haben wir selbst herausgearbeitet, er war Teil der Vorgaben für den Pitch. Das Anliegen der Branche war also, eine höhere Sensibilität in der Bevölkerung für ein längeres Leben zu schaffen. Das ist gar nicht so leicht, denn alle wollen alt werden, aber niemand möchte alt sein. Niemand weiß, wie lange er leben wird, aber es gibt nur eine sehr geringe Begeisterung, sich mit dem eigenen Alter auseinanderzusetzen, geschweige denn mit dem Tod. Vorsorge ist als Thema unsexy, wir schieben das gerne vor uns her.
Mit dem Begriff „Langlebigkeitsrisiko“ kriegen Sie aber auch nicht unbedingt viel Publikum. (lacht) Dabei ist die Gefahr gar nicht so klein, dass wir länger leben, als unsere Ersparnisse reichen. Das ist ein Risiko, das wir als Versicherer abdecken können. Denn eine private Rentenversicherung zahlt, egal wie lange ich lebe. Die Hirschen fanden dann in den dicken Pitch-Unterlagen diese eine Zahl: Die meisten Menschen schätzen ihre eigene Lebenserwartung um sieben Jahre zu niedrig ein. Daraus haben sie dann unseren Claim entwickelt. Wie alt sind Sie übrigens?
46.
Pott: Und wie alt werden Sie wohl?
Vielleicht so Anfang 80?
Pott: Leicht daneben. Statistisch gesehen werden Sie 87,7 Jahre.
Sascha Tegtmeier: Es braucht also einen langen Atem, wenn wir uns als Initiative als Themenexperten positionieren wollen und dabei auf zahlengetriebene Fakten mit unabhängigen Quellen zurückgreifen. Das erste Jahr haben wir vor allem Beziehungen aufgebaut, exklusive Zahlen herausgearbeitet und gute Experten als Gesprächspartner für die Medien gesucht.
Wer ist Ihre Zielgruppe?
Lang: Menschen zwischen 35 und 45.
Pott: Man kann das aber auch weiter fassen. Wir wollten extra keine gut aussehenden Senioren am Meer zeigen, die auf den Horizont blicken. Wenn man sieht, dass das Alter viel mehr Chancen bietet, als es einem das erlernte Bild der eigenen Eltern und Großeltern suggeriert, nimmt das einem die Angst – auch mir persönlich. Die Auseinandersetzung führt zu mehr Wertschätzung und der Erkenntnis: Da kann noch viel passieren. Wir kommunizieren: Um im Alter gut drauf zu sein, muss man heute die Hebel stellen.
Ein gutes Alter besteht aus drei Komponenten: Zuerst brauchen wir alle ein intaktes soziales Umfeld. Man kann nicht erst mit 60 anfangen, sich Freunde zu suchen – die sind aber wichtig fürs Wohlbefinden. Und gerade Männer aus der Generation unserer Eltern sind dafür prädestiniert, die Organisation des Soziallebens ihren Frauen zu überlassen.
Dann müssen wir physisch und psychisch fit sein. Natürlich kann ich auch mit 65 noch mit dem Sport anfangen, besser ist es aber mit 45 oder 35. Und wir brauchen Hobbys und die Chance, uns Wünsche zu erfüllen. Das Leben ist einfach schöner, wenn ich es mir leisten kann, einmal die Woche mit meinem Partner essen oder ins Kino zu gehen. Dafür muss ich finanziell vorgesorgt haben. Und genau diese Bilder nutzen wir in der Kommunikation.
Sie nutzen also rückwärts entwickeltes Storytelling, so dass der Leser selbst darauf kommt, was er braucht.
Lang: Genau, wir führen sokratische Dialoge. Eigene Erkenntnis geht immer tiefer, als wenn mir jemand sagt: Dieser Joghurt ist der beste! Wir sagen: Du wirst länger leben, als du denkst. Und du wirst dabei fitter sein, als du glaubst. Denk dabei nicht an deine Eltern – denn das Bild ist falsch.
Tegtmeier: Wir ziehen heute alle lässig Jeans an, aber viele glauben, dass sie mit 70 nur noch pastellfarbene Anoraks tragen. Wir zeigen ein realistisches Bild aufs Alter, das viel facettenreicher ist als gedacht.
Wenn Sie auf der Webseite dem Nutzer 30 schöne, aber auch ganz alltägliche Dinge zwischen Weltreise, Theaterbesuch, ÖPNV-Ticket oder Haustiernahrung anbieten, die zu seinem Leben im Alter gehören könnten, er sich aber nur sechs aussuchen darf, weil er sich mehr vermutlich nicht leisten kann – was machen Sie mit dem geklickten Ergebnis?
Lang: Gar nichts.
Es wäre ja clever, diese Erkenntnisse fürs Marketing zu nutzen.
Lang: Das ist allein schon datenschutzrechtlich nicht erlaubt und auch nicht unser Ziel. Dieser Rechner soll ein Service mit spielerischem Charakter sein. Die Bedeutung liegt nicht im Ergebnis des Nutzers, sondern dass es das Tool überhaupt gibt.
Tegtmeier: Aber wir haben uns gefreut, als Bild Online das Thema aufgriff und auf den Rechner verlinkt hat …
Sascha Tegtmeier, Ulrike Pott, Alexander Lang und Dennis Schmidt-Bordemann im Gespräch mit Hilkka Zebothsen (c) Johannes Windolph
Wie haben Sie die Arbeit zwischen Verband und Agenturen organisiert?
Lang: Es gibt einen Phasenplan mit den Schwerpunkten der nächsten 18 Monate im Verlauf. Vierteljährlich werden Schwerpunktthemen definiert, und es gibt eine verfeinerte monatliche Themenplanung. Kollegen aus Verband und Agentur verbringen den Montag gemeinsam im Büro. Bis dahin haben alle Ideen gesammelt, die wir dann gemeinsam verdichten, spiegeln und distribuieren.
Da stellt eine Social-Media-Beraterin zum Beispiel den Themenplan für Facebook vor und wir schauen, ob die Geschichte auch nutzbar ist für regionale Medienarbeit. Oder wir haben eine Studie und prüfen, wie wir das für Online aufbereiten und ob wir vielleicht einen Film dazu drehen. Die Ideen entstehen im gemeinsamen Austausch und werden erst dann kanaladäquat aufbereitet.
Tegtmeier: Wir nennen diese Art der Zusammenarbeit die Content-Schmiede. Das läuft ganz anders als auf dem klassischen Weg von Auftrag, Briefing und Umsetzung. Wir sitzen alle in einem Raum – und in dem wird auch mal geschwitzt.
Pott:… und gestritten.
Tegtmeier: Wir sitzen auch hier mit Kollegen aus unterschiedlichen Gewerken auf Kunden- und Agenturseite wie im Newsroom zusammen und entwickeln die besten Formate.
Pott: Und mussten uns erst einmal zusammenraufen. Die Diskussionen im Vorfeld waren durchaus anstrengend, aber sie lohnten sich. Für den GDV ist die Content-Schmiede ein geschützter Raum: Hier können wir Ideen ausprobieren, und wenn sie nicht funktionieren, ist das kein totales Drama.
Für agiles Arbeiten braucht man aber erstmal das Go von oben. War das schwer zu bekommen?
Pott: Wir bekommen von unseren Mitgliedsunternehmen, die die Initiative finanzieren, zugestanden, dass wir einen langen Atem haben können – das ist nicht selbstverständlich. Denn wenn Sie mit wissenschaftlichen Instituten zu einer Studie bis zu einem Jahr im Austausch sind, brauchen Sie eine gewisse Vorlaufzeit. Auch dass wir auf ein Thema setzen, das mit dem Produkt nicht auf den ersten Blick zu tun hat, muss erlaubt sein. Aber wir glauben, dass uns das weiter ans Ziel bringen wird.
Lang: Außerdem sind jeden Montag in der Content-Schmiede auch für ein paar Stunden die Leiter dabei. Wir kondensieren nochmal, was am Vormittag nach der Arbeitswoche besprochen wurde, diskutieren dann auf Meta- und Mikroebene so lange, bis die Idee rund ist. Kunde und Agentur sehen sich viel häufiger als sonst und arbeiten eng zusammen – und bei uns ist das ein integriertes Team von 365 Sherpas, Ressourcenmangel und den goldenen Hirschen. Am Ende des Tages sitzen da vier Parteien am Tisch, die sich committed haben, eine Idee gemeinsam nach vorne zu bringen.
Pott: Wir nutzen auch unseren eigenen GDV-Newsroom, denn die Ansprache der Medien erfolgt klassisch über die Kollegen der externen Kommunikation, die fortlaufend im Kontakt mit Journalisten stehen. Zusätzlich haben wir für die Initiative einen eigenen Presseverteiler aufgebaut, weil einzelne Themen auch mal ganz andere Titel interessieren als Wirtschaftsmedien. Und andersherum freuen sich unsere Mitgliedsunternehmen über Tools, die wir für die Initiative entwickelt haben und die sie selbst im Kundengespräch nutzen können.
Der Facebook-Kanal der Initiative ist kuratiert, den Absender erkenne ich erst beim Blick ins Impressum. Ich lese bunte Geschichten zum Alter, von Senta Bergers neuem Film, über die Lebensgeschichte der ältesten Frau und sehe Fotos vom „heißesten Opa der Welt“. Wer ist da Ihre Zielgruppe?
Pott: Bei uns eher Frauen als Männer.
Schmidt-Bordemann: Die Leser sind auf diesem Kanal sehr abhängig vom Post: Wenn Sie im niedrigen dreistelligen Bereich Werbebudget ausgeben, erreichen Sie bei guter Aussteuerung hunderttausend Menschen. Ein James-Bond-Post hatte zum Beispiel besonders viele Likes von Frauen 50 plus. Generell sind Posts mit Promizitaten die erfolgreichsten.
Lang: Und als wir Udo Lindenberg zum 70. gratuliert haben, hat er das selbst geteilt. Das Geheimnis des Kanals liegt neben der Aussteuerung in der ausgewogenen Mischung aus eigenem Content und geteiltem relevantem externem. In der Agentur denken inzwischen auch Kollegen, die gar nicht für die Initiative arbeiten, mit, da kommt auch mal am Wochenende eine Mail samt Link und der Frage „Wäre das nicht was für den GDV?“. Der „heißeste Opa der Welt“ kam gleich aus vier verschiedenen Ecken.
Schmidt-Bordemann: Aber man darf Facebook nicht insular betrachten, sondern muss den Content immer mit der Microsite verzahnt denken und den Post „Welche Lebensmittel steigern die Lebenserwartung?“ mit Kacheln und vertieftem Inhalt auf die Webseite stellen.
Wie hoch ist das Budget?
Pott: Wir reden nicht über Budgets, aber es ist nicht hoch – und ganz sicher niedriger, als man denkt.
Was lief bisher medial am erfolgreichsten?
Pott: Ein großer Erfolg war „70 ist das neue 60“, das hat zum Beispiel die dpa als Anstoß für einen eigenen Bericht genommen – mit tollen Reichweiten. Nach einem Jahr haben wie Erfahrungen gesammelt, wie wir am besten durch eigene Recherchen unsere Themen in den Markt bringen können, das ist ja eigentlich eine originär journalistische Tätigkeit. Also Geschichten wie die Abwanderung Älterer aus den Städten, Rankings zur Kaufkraft der Rente in den Landkreisen oder wo die meisten über 80-Jährigen in Deutschland leben.
Schmidt-Bordemann: Vieles hätte die Presse von sich aus vermutlich gar nicht gemacht: Die Zahlen zum Durchschnittsalter der Bevölkerung in allen Landkreisen zu besorgen, ist halt aufwändig. Durch das Aggregieren verfügbarer Daten und ihre Aufbereitung, damit sie kommunizierbar sind, heben wir Informationsschätze.
Pott: Und es macht uns stolz, wenn das Max-Planck-Institut für Demografie neue Zahlen zur Lebenserwartung mit uns veröffentlichen will, weil sie dort sagen: „Wir wollen die Zahlen so aufbereitet, dass sie auch jenseits vom Fachpublikum vermarktbar sind.“ Das bestätigt uns, voll auf Fakten zu setzen und das Werbliche wegzulassen.
Ob das funktioniert, hängt davon ab, wie journalistisch wir denken. Aber Karsten Röbisch, der Leiter des Reporterteams im Newsroom, hat lange für die Financial Times Deutschland gearbeitet – und arbeitet für die Initiative heute nicht viel anders als früher für die Zeitung. Zahlen gehen auch immer gut: Wo leben die meisten über 80-Jährigen? Wo kann ich mir das meiste für meine Rente leisten?
Ich muss also im Alter aus Hamburg wegziehen?
Pott: Besser wäre es.
Und was kommt als Nächstes?
Tegtmeier: Anfang des Jahres bieten wir eine wissenschaftlich basierte Rentner-Typologie an: Anhand von zehn Fragen kann man herausfinden, ob man im Alter eher der Abenteurer, der Engagierte, der Besorgte oder die Lieblingsoma sein wird. Wir haben dazu Zahlen und Fakten und einen Online-Test, so kann der Content vielfältig genutzt werden: Die Medien berichten über die Untersuchung und jeder Leser kann sein Testergebnis bei Facebook posten: „Hej, ich bin im Alter ein Abenteurer – und du?“. Das ist Wissenschaft mit einem Augenzwinkern.
Schmidt-Bordemann: Außerdem wollen wir weiter den gesellschaftlichen Dialog anstoßen und planen ein so genanntes Grünbuch: Wir werden in Berlin für vier bis sechs Monate mit verschiedenen Stakeholdern und Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik das Thema Lebenserwartung, die Herausforderungen für das gesellschaftliche Zusammenleben diskutieren und Themen wie Flüchtlinge und schleichende Disruption verbinden. Am Ende erschaffen wir ein Grünbuch mit Handlungsempfehlungen.
Tegtmeier: Wir wollen, dass Langlebigkeit in allen politischen Prozessen mitgedacht wird. Also bieten wir eine Plattform im Sinne eines Mindsets, indem wir Menschen zusammenbringen, die etwas zu sagen haben.
Pott: Wir brauchen dazu auch die Arbeitnehmer und die Unternehmen. Denn wenn ich länger lebe, heißt das auch, dass ich länger arbeiten muss. Das begrüßen nicht alle, aber dem müssen wir uns stellen. Wir brauchen einen Diskurs darüber, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen. Alte möchten nicht in der Pampa wohnen, aber müssen es sich auch leisten können, in der Stadt zu leben. Die Politik plant jede Menge Kitas und Schulen – aber Altenheime oder Alters-WGs? Wir wollen keine Panik auslösen, sondern das Thema rechtzeitig angehen, damit man es mitgestalten kann.
Schmidt-Bordemann: Wenn Andrea Nahles bei der Vorstellung ihrer Programme von ihrem Vater erzählt, der als Dachdecker mit 70 Jahren starb, ist klar, dass sie gegen die Rente mit 70 ist. Aber wer heute 30 ist, muss damit rechnen. Vielleicht müssen wir also den klassischen Lebenslauf von Ausbildung, Job, Familiengründung, Karriere bis zur Rente aufbrechen und mit 30 eine längere Auszeit nehmen, um später länger arbeiten zu können.
Lang: In unserem Altbau ohne Fahrstuhl lebt eine 90-Jährige in der vierten Etage. Sie hat sich im zweiten Stock einen Hocker ins Treppenhaus gestellt, um auf dem Heimweg eine Pause machen zu können. Wir werden also mit unserer Initiative die Herausforderungen der längeren Lebenszeit benennen, internationale Vergleiche ziehen und Impulse sammeln für den gesellschaftlichen Diskurs.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe FÜHRUNG. Das Heft können Sie hier bestellen.