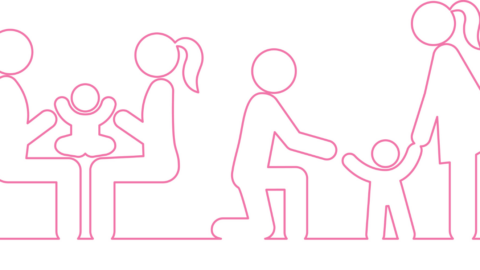Kürzlich sollte ich einen Vortrag auf einer Tagung für Personaler halten. Mein Vorredner war ein prominenter Mann. Sein Thema: Glück bei der Arbeit. Seine These: Wer es nicht gefunden hat, ist selbst schuld. Sein Beleg: eine wahre Geschichte, die ans Herz geht.
Ein Herzchirurg in Zürich rettet Leben, verdient viel Geld, ist renommiert. Mit 56 Jahren fällt ihm ein, dass seine Leidenschaft das Lkw-Fahren ist. Er macht den Lkw-Führerschein, tauscht Skalpell gegen 460 PS und brettert mit 40 Tonnen über die Straßen Europas. Seine Verwandlung erregt Aufsehen. Viele von Ihnen werden solche Geschichten kennen.
Das Publikum schaut gerührt: Ja, so einfach ist es, mit seiner Arbeit glücklich zu sein. Was mache ich falsch?
Ich beschließe, meinen vorbereiteten Vortrag zur Seite zu legen. „Stellen wir uns vor“, lade ich die Gäste ein, „die Geschichte hätte umgekehrt begonnen: Ein Lkw-Fahrer findet mit Mitte fünfzig heraus, dass sein Lebenstraum darin besteht, als angesehener Herzchirurg zu arbeiten.“
Weiter komme ich nicht, Gelächter bricht aus. Die inspirierenden Erzählungen von Menschen, die ihrem Herzen folgen und plötzlich etwas ganz anderes machen – manchmal müssen wir sie nur umdrehen, um zu merken, welchem Blödsinn wir aufsitzen.
Gutgemeinte Ratschläge helfen nicht
Die Geschichten schaden, denn sie suggerieren zweierlei. Erstens: Es ist so leicht, eine Arbeit zu machen, für die man brennt; nur Trottel tun das nicht. Zweitens: Leidenschaft ist das Maß der Dinge im Arbeitsleben. Beides ist falsch. „Einfach nur der Leidenschaft folgen“ – das ist eben doch nicht so einfach. Die Masse der Gesellschaft besteht nicht aus berühmten Herzchirurgen, sondern aus Lkw-Fahrern, wörtlich und im übertragenen Sinn.
Der Lkw-Fahrer steht für alle, die nicht einfach „nur“ herausfinden müssen, was sie erfüllt, und daraus ab morgen einen Beruf machen. Bankangestellte, Krankenschwestern, Pressesprecher, Agenturchefinnen mit Investitionen und Verantwortung: Die Masse der arbeitenden Bevölkerung kann ihren Job nicht wechseln wie ein Profilfoto auf Facebook.
Das hat nicht nur mit Ausbildung und Hierarchieebene zu tun: Es gibt mittlere Manager, die Studium, glänzende Referenzen und einen Traum haben. Sagen wir, von der eigenen Surfschule in Kalifornien. Sie haben aber auch Ehepartner und Schulkinder und haben ein Haus gebaut. „Wenn die Surfschule dein Glück ist, worauf wartest du?“ – dieser Rat hilft der Abteilungsleiterin so wenig wie ihrem Assistenten.
Wohlklingende Versprechen
Dass etwas schwer zu erreichen ist, spricht noch nicht dagegen, es sich zum Ziel zu setzen. Ist es eben ein anspruchsvolles Ziel. Leidenschaft zum Maß der Dinge zu erheben wäre sinnvoll, wenn leidenschaftliche Arbeit eine Garantin für gute Ergebnisse und ein zufriedenes Leben wäre.
Danach klingt ja das Leidenschaftsgeklingel, das heute in Leitbildern und anderem Unternehmenssprech wuchert: Mitteilungen schreiben, Überweisungen ausführen, Hoteltoiletten schrubben – all das wird „mit“, wenn nicht „aus Leidenschaft“ gemacht. Hier leisten begeisterte Menschen gute Arbeit, wollen die Unternehmen damit sagen. Es ist das Pendant zur „guten Milch von glücklichen Kühen“. Wer die Leidenschaftsthese überprüfen will, schaue eine Folge „Deutschland sucht den Superstar“. Dort bewerben sich Musiker um einen Plattenvertrag. Es wimmelt von Menschen, die vor Leidenschaft für die Musik platzen – und atemberaubend schlecht singen.
„Deutschland sucht den Superstar“ ist ein kurzweiliger Beweis dafür, was Leidenschaft mit der Frage zu tun hat, ob jemand seine Arbeit gut macht. Die Antwort lautet: nichts. Das Kundenversprechen, das Unternehmen mit der Behauptung verbinden, bei ihnen gehe es leidenschaftlich zu, habe ich noch nie verstanden.
Die Floskeln leidenschaftlicher Versager
Außerhalb des Fernsehens gibt es weniger unterhaltsame, aber nicht weniger überzeugende Belege gegen die Leidenschaftsthese. Rechtsanwälte beherzigen die Regel, sich in einer wichtigen Angelegenheit nicht selbst zu vertreten. Ärzte operieren ungern Angehörige. Der Grund: zu viel Leidenschaft, weil man betroffen ist, weil die Distanz fehlt. Ich selbst möchte meine Bücher lieber von jemandem mit nüchternem Kopf vermarktet wissen als von jemandem, dessen Hände vor Leidenschaft zittern.
Was bei vielen Unternehmen im Argen liegt, hat nichts mit zu wenig Leidenschaft zu tun. Es sind scheinbar banale Dinge, deren Fehlen die täglichen Fehler auslöst: Sorgfalt und Zuverlässigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit.
Einen Termin im Kalender eintragen. Eine E-Mail gewissenhaft lesen. Einer Kundin oder einem Mitarbeiter genau zuhören. Ein Rückrufversprechen einhalten. Nachdenken, bevor man spricht. Sich am nächsten Tag an das erinnern, was man gesagt hat, und sich daran messen lassen. Korrekt schreiben und rechnen.
Eine Pressemitteilung ohne Fehler zu verfassen ist wichtiger, als sie mit Leidenschaft zu verfassen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie man denken mag. Jeder von uns kennt Beispiele, in denen selbst der Name eines Interviewpartners falsch geschrieben ist oder der Termin in einer Veranstaltungsankündigung verwechselt wurde. „Sorry, das ist mir durchgerutscht“ gehört zu den alltäglichen Floskeln der leidenschaftlichen Versager.
Für diese schlichten Anforderungen braucht man Besonnenheit und die Bereitschaft, sich mit Details zu beschäftigen. Leidenschaft ist die Gegenspielerin dieser Fähigkeiten. Sie schafft ein erregtes Grundrauschen, das nüchterne Distanz zum eigenen Handeln zerstört. Sie täuscht mit flotten Floskeln darüber hinweg, dass gute Arbeit oft aus unglamourösen Zutaten entsteht.
Ein Schleier des Unglücklichseins
Einsteiger erleben einen Schock, wenn sie erfahren, wie sich der Arbeitsalltag von dem unterscheidet, was sie aus Ausbildung und Medien kennen. Im Studium ist die Kurve steil. Kein Stillstand, keine Routine. Dass es in der Berufsausübung umgekehrt sein wird, sagt uns niemand. Aus anderen Quellen erreichen uns keine Informationen, die dieses Bild korrigieren. Kommt das Arbeitsleben in Büchern, Zeitungen, Film oder Fernsehen vor, geht es nie um Alltagsroutine. Sie bietet keinen Stoff für eine Geschichte, weder für Reportage noch Fiktion.
Ein Arzt rettet jede Sekunde Leben. Die Stewardess eines Kreuzfahrtschiffs bringt Menschen zusammen (Traumhochzeit folgt!). Journalisten decken den großen Skandal auf. Ein Getränk servieren, ein Formular ausfüllen, eine Kostenstelle eintragen, ein Interview redigieren – was 95 Prozent der dargestellten Berufe ausmacht, findet in den Medien nicht statt.
Es gibt Menschen, die leidenschaftlich arbeiten und mit ihrem Leben glücklich sind. Es gibt Menschen, die leidenschaftlich arbeiten und mit ihrem Leben unglücklich sind. Und es gibt glückliche Menschen, die für ihren Beruf nicht brennen. Leidenschaft bei der Arbeit steht in keinem zwingenden Verhältnis zu einem gelungenen Leben. Und zur Qualität der Arbeit sowieso nicht.
Es ist der Leidenschaftszwang, der über Generationen einen Schleier des Unglücklichseins gelegt hat. Dass wir so tun, als wäre Leidenschaft bei der Arbeit Normalfall und Idealfall zugleich: Wer seine Arbeit nicht mit an Besinnungslosigkeit grenzender Hingabe verrichtet, ist sich und anderen suspekt. Millionen sitzen im Büro, stehen am Fließband oder hinter der Theke und fragen sich: Was läuft falsch bei mir, wenn ich dabei keine Leidenschaft spüre? Sie suchen, grübeln und verzweifeln, weil in ihrem Leben etwas nicht „stimmt“.
Nehmen wir also den Leidenschaftsdruck raus! Seine Arbeit gut zu machen, statt sie nur gut zu finden – das kann ganz schön zufrieden machen. Und ganz schön erfolgreich.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe SPASS. Das Heft können Sie hier bestellen.