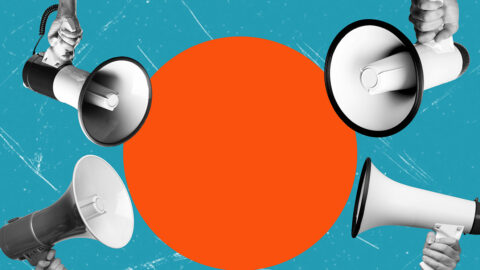Auf meinen letzten Kolumnenbeitrag über die eigenartig radikale Rhetorik der Lokführer-Gewerkschaft GDL habe ich mehrere Reaktionen erhalten. Ein früherer Kollege aus dem Fachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Deutschen Journalisten-Verband (DJV) schrieb mir zum Auftreten der GDL und ihres Vorsitzenden Claus Weselsky, es sei „vielleicht nicht nur die Rhetorik, sondern auch ein schlichtweg schlechtes Beispiel, das die ‚gute Sitte eines Streiks‘ auf den gesellschaftlichen Prüfstand bringt“.
Dieses schlechte Beispiel, mit dem die GDL (oder auch Verdi et cetera pp.) vorangeht, erklärt dann auch, warum immer mehr Gruppen und Repräsentanten branchen- und parteiübergreifend das Streikrecht hinterfragen. Denn einstmals eingeführt, um schlechte oder gesundheitsschädigende Arbeitsverhältnisse und Ausbeutung zu verhindern und einem sozialen Machtgefälle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu begegnen, scheint es mitunter auch missbraucht zu werden, um in regelmäßigem Turnus auch bei vergleichsweise gut bezahlten Berufen oder Schicht-Zulagen noch eine Schippe oben drauf zu kippen.
Streiks beseitigen keine soziale Ungerechtigkeit
Um es zu differenzieren: Ja, wenn Pflegedienste in Kliniken fast rund um die Uhr arbeiten und ihre Überstunden nicht ausgleichen können, muss eine Lösung her. Wenn Pressesprecher, die für Veröffentlichungen ihrer Behörden oder kommunalen Betriebe die Verantwortung tragen, beim Gehalt weit unter Referenten-Niveau (also A13) eingruppiert werden, dann ist das einfach nicht gerecht. Ebenso ungerecht ist es, wenn Geschäftsführer oder Vorstände eines Unternehmens (ob staatlich oder privat) das Hundertfache von dem erhalten, was sie den Mitarbeitern vor Ort zahlen. Ja, solche Missstände müssen geändert werden.
Das wurde aber bislang noch durch keinen Streik erreicht. Ganz im Gegenteil: Wenn es am Ende für alle (!) wieder ein paar Prozentpunkte mehr oder ein paar Arbeitsstunden weniger gibt, klafft – bei prozentual gleicher Behandlung – die Realschere zwischen Viel und Wenig immer weiter auseinander. Die Ungerechtigkeit verschwindet also nicht, sondern sie wird noch größer.
Miese Worte machen einen miesen Charakter – und umgekehrt
Soweit die politische Einschätzung des „schlechten Beispiels“. Der Satz des Kollegen hat mich aber noch an etwas anderes erinnert: an die Kombination von Rhetorik – oder Kommunikation allgemein – und Handeln. Konkret ging mir folgende Redewendung durch den Kopf:
„Achte auf deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
Achte auf deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten,
denn sie werden dein Charakter.“
Ein mieses Wort macht also einen miesen Charakter. Vielleicht auch umgekehrt. Jedenfalls erleben wir eine kommunikative Dauer-Miesepetrigkeit und verbale Radikalisierung, die von Interessengruppen und Gewerkschaften – Verdi und Landwirte respektive Bauern überziehen hier genauso wie die GDL – vorangetrieben und auch in der Sprache mancher Politiker gepflegt wird.
Legen wir das oben genannte Zitat zugrunde, lautet die These also: Die Radikalisierung im Wort führt über kurz oder lang zur Radikalisierung im Handeln. Und vor genau dieser Gewaltspirale haben Autoren schon vor Jahren gewarnt. In der Wochenzeitung „Die Zeit“ erschien 2019 ein Beitrag darüber, „wie aus Sprache Gewalt wird“. Im Vorspann heißt es: „Dem Mund, der Hassparolen brüllt, folgt die Faust: Über die Brutalisierung der öffentlichen Rede und die dramatischen Konsequenzen für die Demokratie“. Ein Jahr später warnte die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einem Interview mit dem Deutschlandfunk vor einer „Radikalisierung des öffentlichen Sprechens“. Und heute blockieren Bauern mit Traktoren Autobahnen und Schiffsanleger oder verhindern die Verteilung der Tageszeitung. Was kommt als Nächstes?
Kommunikation und Kultur gehören zusammen
In einer PR-Agentur, in der ich vor meiner nun schon fast 22-jährigen Selbstständigkeit als Redakteur und Berater tätig war, haben wir mit einem Modell gearbeitet, das die Bezüge von Unternehmenskultur und Unternehmenskommunikation zeigte: Der Umgang miteinander prägt die Kommunikation nach innen und außen. Umgekehrt genauso. Handeln und Reden haben ihre gemeinsame Basis in der Unternehmensstrategie. Wer es sich also zur Strategie macht, verbal einfach immer nur draufzuhauen, um zu punkten, der schafft eine solche Spirale: Am Anfang war das Wort, dann folgt die Tat.
Oder wie es Juli Zeh in ihrem Roman „Über Menschen“ schreibt: „Seit Jahrzehnten haben sich Politik und Medien darauf spezialisiert, die niedersten Instinkte der Menschen anzusprechen – Angst, Neid, Egoismus. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwann eine Partei wählen, die genauso wehleidig ist wie sie selbst.“
Verzicht auf reißerische O-Töne
Den Nachrichtenmedien, den unzähligen Talk-Formaten und manchem Social-Media-Kanal kommt dabei die unrühmliche Rolle zu, sich zu Multiplikatoren solcher Ausuferungen gemacht zu haben, indem sie ihnen eine Plattform bieten. Ein bisschen mehr objektive Fakten statt mitreißender O-Töne wären da manchmal angemessen. Denn eines zeigen die O-Töne ja: Je zugespitzter, desto besser verkaufen sie sich. Redaktionen vor allem der politischen und Tagesmedien müssen aufpassen, dass sie selbst auf dieses Kalkül nicht hereinfallen, sondern erkennen können: Was ist wirklich objektiv kritisch zu sehen, und wo wird ein Sachverhalt von Person X (egal ob Bauernverband, Friedrich Merz oder Verdi) bewusst in übersteigerten Farbformaten grell negativ ausgemalt?
Streiten kann man, das gehört zur Demokratie. Und die ist bekanntlich „kein Schaukelstuhl“ (Franz Müntefering), in den man sich zurücklehnt und döst. Die Medien sollen diesen inhaltlichen Disput auch abbilden und die einzelnen Seiten und Argumente verständlich darstellen. Wer aber statt sachlicher Auseinandersetzung vor allem auf die Inszenierung des Streits Wert legt (auch hier: je doller, desto besser), macht sich mitschuldig, wenn Demokratiekultur radikalisiert wird, sich hochsteigert und in undemokratisches Handeln mündet. Das gilt für Medien ebenso wie für Gewerkschaften und Politiker.
Übrigens: Falls Sie bei dem Zitat oben („Achte auf deine Worte …“) instinktiv an Anselm Grün, die Bibel oder den Talmud denken: Vergessen Sie’s. Die Quelle ist eine andere, darüber schreibe ich aber erst beim nächsten Mal.