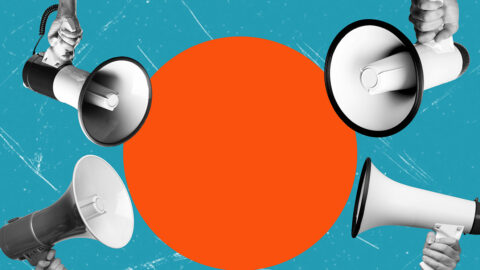„Unsere derzeitige geschäftliche Situation ist sehr ernst“, schrieb der Vorstand des Automobilzulieferers Continental im Spätsommer an weltweit 400 Führungskräfte. Ein halbes Dutzend der 27 Geschäftsbereiche habe wiederholt selbstgesteckte Ziele nicht erreicht: „Daher die klare Ansage: Auf diesem falschen Gleis fahren wir keinen Meter mehr: Dieser Zug stoppt genau hier und jetzt!“
Die Metapher hätte auch zu Richard Lutz gepasst. Der Vorstandschef der Deutschen Bahn wandte sich ebenfalls kürzlich mit einem Brandbrief an die eigenen Führungskräfte. In seiner selbstkritischen Problemanalyse monierte er unpünktliche Züge, hohe Kosten, verfehlte Gewinnziele und einen wachsenden Schuldenberg. „Natürlich hat auch die Hitzewelle der letzten Wochen ihren Einfluss gehabt“, schrieb Lutz. „Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört aber auch, dass wir unsere eigenen Themen wie zum Beispiel die Fahrzeugverfügbarkeit schlicht nicht im Griff haben.“ Es gebe „nichts zu beschönigen“.
Und noch ein Beispiel für einen Brandbrief von prominenter Stelle: Im Sommer kritisierte Deutsche-Post-Vorstandschef Frank Appel in der internen Konzernzeitschrift Premium Post seine Mitarbeiter scharf: „Wir arbeiten nicht wirklich als ein Team – und das beziehe ich auf alle Ebenen.“ Der CEO mahnte einen Kulturwandel im Unternehmen an und forderte: „Jeder Einzelne muss Verantwortung für seinen Bereich übernehmen, Dinge infrage stellen und gegebenenfalls verändern.“
Blut, Schweiß, Tränen und ein Ruck
Schlechte Zahlen, Geschäftsfeld-Egoismen, mieses Teamwork – Anlässe für Brandbriefe gibt es viele. Der auf Krisenkommunikation spezialisierte Unternehmensberater Peter Höbel hält die derzeitige Häufung solcher brisanter Schreiben in den vergangenen Monaten allerdings für zufällig: „‚Blut, Schweiß und Tränen‘-Rundschreiben gab es früher schon. Sie sind nur nicht in dieser Form publik geworden. Der Brief als solcher ist eher oldschool.“
Ein Brandbrief ist eine Art aufgeschriebene Rede. Ein frühes Vorbild ist die „Blood, sweat and tears“-Rede, mit der Sir Winston Churchill am 13. Mai 1940 vor dem britischen Unterhaus die Briten auf einen Sieg im Zweiten Weltkrieg einschwor. Hierzulande ging am 26. April 1997 der damalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog mit seiner „Ruck-Rede“ in die Geschichte ein. Herzog forderte damals: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“
Das Wesen der Brandrede ist es, Missstände klar zu benennen, Stakeholder zu einem Richtungswechsel zu drängen. „Wenn ich Mitarbeiter effektiv mit Botschaften erreichen will, die aus dem Grundrauschen herausragen, schaffe ich das selten mit einem Pod- oder Videocast“, sagt Höbel. „Dazu brauche ich eine Marke, die sichtbarer wirkt. Ein Brief ist eine Art Kommunikations-Leuchtturm. Sie erreichen damit mehr Aufmerksamkeit als mit konventionellen Mitteln der internen Kommunikation.“ Bedingung dafür ist Höbel zufolge, dass es selten angewandt wird. „Wenn Sie so ein Mittel inflationieren, nutzt es sich ab.“
Eine Frage der Botschaft und des richtigen Tons
Felix Gress, Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs bei Continental, bestätigt das. „Der Brief war als ein deutlich vernehmbarer Impuls gedacht und hat so gewirkt. Die meisten der 400 adressierten Führungskräfte sagen, dass sie ihn in der Sache vollkommen richtig finden, aber im Ton unpassend. Viele waren darüber erstaunt, teils auch verunsichert.“
Macht der Ton die Musik? „Wie so häufig ist es eine Frage der Formulierung, ob sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt“, sagt Krisenkommunikationsexperte Höbel. „Nicht ganz so wichtig ist dabei, ob Redenschreiber oder Kommunikatoren in den Texten exakt den richtigen Ton treffen. Der entscheidende Punkt ist die zentrale Botschaft.“
Sebastian Rudolph, Head of Corporate Communications and Public Affairs bei Bilfinger, sagt: „Wenn ich als Vorstand einen Brief an die Führungsmannschaft schicken will, muss ich mir vorher genaue Gedanken über die Art der Tonlage machen.“ Der Industriedienstleister Bilfinger steckt seit Jahren in einer Krise. Vor drei Jahren hatte der ehemalige Vorstandschef Per Utnegaard mit einem Brandschreiben ungewöhnliche Einblicke in die Befindlichkeit des Konzerns gewährt. „Nach mehreren Gewinnwarnungen ist das Vertrauen der Öffentlichkeit und des Kapitalmarkts in Bilfinger auf einen Tiefpunkt gesunken“, schrieb er. Und: „Der Markt kennt kein Mitleid mit ineffizienten Unternehmen.“
Harte Worte, die nicht bei jedem gut ankamen. Inzwischen hat Bilfinger verbal abgerüstet. „Bei aktuellen oder brisanten Themen ziehen wir Video- beziehungsweise Telefonschaltkonferenzen vor, weil hier eine direkte persönliche Ansprache möglich ist“, sagt Rudolph. „Die Teilnehmer können sofort interagieren, was bei einem Brief nicht der Fall ist.“
Continental-Sprecher Felix Gress sieht das Ziel, durch das Schreiben die volle Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit des Unternehmensumbaus zu lenken, als erreicht an. „Und zwar besser als die zuvor unternommenen Schritte.“
Gress verweist auf zahlreiche Reaktionen im Intranet, per E-Mail und in persönlichen Gesprächen bei Conti. „Die Führungskräfte und Mitarbeiter fragen sich, wie der Brief einzuordnen ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Denn er durchbricht bewusst die Erwartungen aus unserer bisherigen Kommunikation, die auf den persönlichen, direkten, hierarchieübergreifenden Austausch gesetzt hat und dies weiter tun wird.“
Der Brandbrief ist nur eine „Zwischenstufe“
Bedenken, der Vorstand zeige mit dem von ihm angestoßenen Brandbrief womöglich, dass er ein Problem nicht lösen konnte, haben die Kommunikatoren bei Conti intern diskutiert. Da Continental trotz der jüngsten Prognoseänderung aber in guter Verfassung sei, habe man zu dem Mittel gegriffen. „Die Frage ist weniger, wie wir kurzfristig Feuer löschen, sondern wie wir unsere Zukunftsfähigkeit sichern“, sagt Gress. Ein Brandbrief ist für ihn somit nicht die letzte Stufe in einer Kette von Kommunikationsmaßnahmen, sondern eine Zwischenstation. Es stehe eine weltweite Management-Konferenz an, auf der es konkret um Zukunftsthemen von Conti gehen wird.
Die Kommunikatoren der Deutschen Bahn halten den Ball nach den heftigen Reaktionen auf den Brandbrief von Richard Lutz eher flach. „Ein Vorstandsbrief an die Führungskräfte oder an alle Mitarbeiter ist nichts Ungewöhnliches in der internen Kommunikation der DB“, sagt Dagmar Kaiser, Leiterin Kommunikation Personal bei der Deutschen Bahn. „Der jüngste interne Brief des Vorstands ist ein normaler, eingeübter Weg, den die Führungskräfte kennen. Inhaltlich ging es darum, Ziele und Ergebnisse zu sichern, nicht mehr und nicht weniger.“
Richard Lutz hatte im einzigen Statement zu seinem Brief im Gespräch mit dem Deutschlandradio Mitte September die Tonlage vorgegeben: „Es gibt nichts zu beschönigen, aber auch nichts zu dramatisieren.“
„Unter drei“ bleiben brisante Schreiben selten
Für Peter Höbel sind Brandbriefe abhängig von der Botschaft und den adressierten Stakeholdern auch ein Instrument der Krisenkommunikation. Würden indirekt auch Endkunden angesprochen, wirkten Brandbriefe ein Stück weit wie ein Marketingmittel.
Er sagt: „Wenn der Bahn-Chef die DB-Mitarbeiter intern zu verstärkten Anstrengungen aufruft, will er damit gleichzeitig extern die über Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit verärgerten Bahnkunden einfangen.“ Und möglicherweise auch die Bundesregierung, die ein Insider der Kommunikationsbranche in Berlin als den eigentlichen Adressaten des Lutz’schen Brandbriefs vermutet.
Brandbriefe richten sich in Unternehmen formell zwar an eigene Führungskräfte und Mitarbeiter. „Unter drei“ bleiben sie deshalb noch lange nicht. „Es wäre naiv, wenn Kommunikationsprofis glauben würden, dass ein Dokument, das im Unternehmen in einer nennenswerten Anzahl gestreut wird, intern bleiben würde“, betont Höbel. „Wenn ein CEO einen Brief an die Mitarbeiter schreibt, ob in Mitarbeiterzeitungen oder im Intranet, dann ist das immer auch eine gezielte Botschaft nach außen.“
Conti-Sprecher Felix Gress beteuert: „Wir haben den Brief nicht an die Öffentlichkeit durchgesteckt – und es hätte auch keiner öffentlichen Verstärkung der Worte bedurft. Aber natürlich war uns klar, dass er an die Medien gelangen kann. Wir haben das in Kauf genommen.“
Ob die Häufung von Brandbriefen in der Unternehmenskommunikation in Deutschland nur gefühlt ist oder nicht, sie scheinen in eine Zeit zu passen, in der – Stichwort Flüchtlings-, Koalitions-, Finanzkrise – gefühlt permanent Krise herrscht. Gress: „Wir leben offenbar in einem Zeitalter, in dem wichtige Themen erst oder vor allem als empörende Krise ausreichend wahrgenommen werden.“
Privileg der Arbeitgeberseite sind Brandbriefe im Übrigen keineswegs. Mitarbeiter der Berliner U-Bahn wendeten sich im August mit einem geharnischten Schreiben an die Führung ihres Arbeitgebers, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Sie beklagen darin dramatische Personallücken und massive Überlastung der Angestellten. Von fehlenden Fahrzeugen ist die Rede, von kaputten Zügen und löchrigen Schichtplänen.
Inzwischen hat der Vorstand der BVG geantwortet. Er verspricht neue U-Bahn-Wagen und Einstellungen im Werkstattbereich. Ob sich etwas ändert, muss sich erst noch zeigen. Denn eines ist, wie Conti-Sprecher Gress es formuliert, wohl klar: Ein Brief allein ändert gar nichts.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KONKURRENZ. Das Heft können Sie hier bestellen.