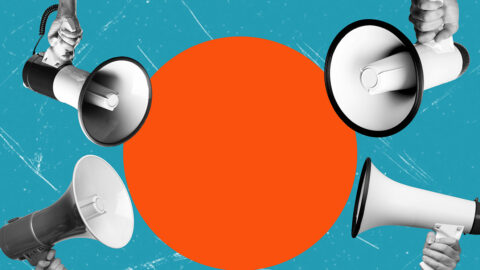„Sich das Rauchen abzugewöhnen, ist total einfach. Ich habe es schon dreimal geschafft.“
Diesen Spruch mag ich, auch wenn er schon alt ist. Ähnlich alt wie die Behauptung, ein Journalist könne, wenn er einmal die Schreibtischseite gewechselt habe, nicht aus der PR in den Journalismus zurück.
Stimmt nicht. Das habe ich tatsächlich schon dreimal gemacht. Ob ich dabei in dem einen Job vom Handwerkszeug des anderen profitieren konnte, wollte die pressesprecher-Redaktion wissen. Jawohl, konnte ich.
Es ist nicht überraschend, welches journalistische Handwerkszeug ich in der PR besonders gut brauchen konnte: Klar, das Schreiben. Wer oft genug Meldungsspalten mit möglichst vielen Infos zu füllen hatte, der beherrscht den knappen Hauptsatz. Der verwendet aktive Verben, schmeißt Worthülsen wie „im Rahmen der Sonderaktion“ automatisch raus. Wer Nachrichten schreiben kann, schreibt bessere Pressemitteilungen.
Zum Journalismus gehört auch die Bandbreite seiner Stil- und Darstellungsformen. Als Ex-Journalist finde ich es immer wieder erstaunlich, wie wenige Genres die PR-Kollegen in Mitarbeiter- und Kundenzeitschriften nutzen. Fast nur Nachrichten und Berichte, dazu ein paar Interviews, in denen nicht mal richtig nachgehakt wird. Laaaaaangweilig! Wo sind die Reportagen, die Features und die Glossen? Warum nicht mal ein wirklich persönliches Porträt? Ein Gastkommentar? Als Jury-Mitglied der Deutschen Public Relations Gesellschaft habe ich in diesem Jahr viele aufwändig erstellte Mitarbeiter-Publikationen gelesen. Selbst in diesen zur Auszeichnung eingereichten Heften gab es nur extrem wenige Geschichten jenseits von Bericht und Interview.
Aus dem Journalismus lässt sich obendrein Sicherheit in den einzelnen Stilformen mitbringen. Nachricht und Kommentar beispielsweise haben nix miteinander zu tun. Nein, auch in der Personalmeldung nicht. Wenn die Tageszeitung kurz meldet, dass Max Mustermann neuer Amtsleiter ist, dann steht doch nicht am Ende: „Wir wünschen ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg.“ Absurd.
In Mitarbeitermedien steht so etwas ständig. Ja, ja, ich weiß, das soll höflich sein. Ist es aber nicht. Das ist einfach nur eine lieblos hintendran geklatschte Floskel, die gegen journalistische Regeln verstößt. Und gegen Lese-Erwartungen: Mitarbeiter kennen das anders, sie lesen ja schließlich Personalmeldungen auf Spiegel Online, im „Stern“ oder auf kicker.de. Sie werden den Text daher als unprofessionell wahrnehmen.
Die richtigen Fragen stellen
Aus der journalistischen Zeit habe ich auch die stete Frage mitgenommen, was das Publikum eigentlich interessiert. Kurz nachdem ich das zweite Mal Pressesprecher wurde, musste ich in einer ziemlich unangenehmen Sache vor die Presse: Uns, in diesem Fall einer Justizvollzugsanstalt, waren neun Gefangene gleichzeitig abhanden gekommen. Im ersten Reflex habe ich überlegt, was ich dazu sagen könnte, damit das noch irgendwie okay klingt. Doch dann war ich froh um die journalistische Schule – mir war klar, was die Menschen da draußen interessieren würde, folglich konnte ich mir die Fragen der Journalisten ausrechnen. Das war dann die eigentliche Vorbereitung: Die Fachleute peinlichst genau zu befragen und mir zu überlegen, was ich aus den Antworten machen könnte.
Dieses Handwerkszeug habe ich selbstverständlich auch bei der Vorbereitung auf Pressekonferenzen genutzt: Ich habe mich in die Rolle der Medien versetzt und überlegt, womit ich „die da vorne“ am besten aus der Ruhe bringen könnte. Dabei kamen reichlich fiese Fragen raus, die ich dann vorab denjenigen gestellt habe, die auf dem Podium sitzen sollten. Eine zeitweilige Vorgesetzte mit wenig Medien-Erfahrung fand das überhaupt nicht witzig: „Für wen arbeiten Sie eigentlich?“ schrie sie mich an.
Bleiben wir bei den Fragen, wechseln aber die Seite des Schreibtischs: Als Pressesprecher erlebt man, wer was fragt. Ist ja klar. Insofern bekommt man auch mit, welche Fragen neu sind, welche sogar wirklich überraschen. Das sind verflixt wenige – und sehr viel weniger als die meisten Journalisten glauben. Wie oft habe ich diesen triumphierenden Unterton gehört, wenn Medienvertreter sicher waren, etwas besonders Originelles gefragt zu haben. Hatten sie fast nie. Wie peinlich das dann wirkt. Mancher Journalist glaubt sich kurz vor einem hoch dotierten Preis für besonders investigative Berichterstattung, dabei ist er alleine in dieser Woche der Zwölfte, der mit dem Thema um die Ecke kommt.
Das habe ich mir gemerkt. Auf journalistischer Seite habe ich später sehr darauf geachtet, dass ich meine Fragen nicht zu stolz gestellt habe. Vorteile hatte das auch: Wer nicht ganz so nass-forsch fragt, bekommt auch mal einen Tipp aus der Kommunikationsabteilung, welcher Aspekt an der Geschichte tatsächlich neu sein könnte. Dank des Pressespiegels weiß man dort doch viel genauer, was dazu schon gelaufen ist – und was noch nicht.
Pressespiegel verzerren die Wirklichkeit
Ach ja, der Pressespiegel. Tag für Tag liest man seitenweise Texte zu den eigenen Themen, da muss man ja glauben, alle Medien seien voll davon. Vermutlich meint selbst der Kommunikator eines Keksdosen-Herstellers, dass Weißblech und die Hygieneprobleme bei der Rollfalz genau die Themen sind, die große Bevölkerungsteile tagtäglich umtreiben. Zurück im Journalismus hat mich immer wieder verblüfft, wie viel Tunnelblick sich während der Pressesprecherei eingeschlichen hatte.
Dank der Pressespiegel kennt man sich natürlich mit den Themen aus. Überhaupt sind die Unternehmens-, Verbands- und Behördensprecher natürlich tiefer drin in der jeweiligen Materie. Einerseits brauchen sie sich natürlich nur mit den Themen zu beschäftigen, um die sich der Arbeitgeber kümmert. Da ist die thematische Bandbreite der meisten Journalisten erheblich größer. Trotzdem: Zu meinem großen Erstaunen gehört die sorgfältige Recherche eher zum Handwerkszeug der Pressesprecher. Für sie ist es existenziell, den Inhalt zu durchdringen. Der Anspruch besteht selbstverständlich auch auf der Seite der Medien, aber Zeitdruck verhindert oft, dass er auch eingelöst wird. Doch ich glaube, wer von der PR in den Journalismus wechselt, wird dieses Handwerkszeug mitbringen: nicht nur der spannenden und gut zu erzählenden Geschichte nachzuspüren, sondern dem eigentlichen Sachverhalt.
Verständlichkeit und Präzision sind keine Kumpels
Wenn es daran geht, die wahrhaftige Geschichte interessant zu erzählen, können die beiden Seiten wechselseitig voreinander lernen. Daher bin ich sicher: Wer längere Zeit auf der einen Seite gearbeitet hat, wird davon auf der jeweils anderen profitieren. Journalisten werden darauf gedrillt, verständlich zu texten. Da pflanzt Peter Müller einen Baum, statt „im Beisein zahlreicher geladener Gäste maßgeblich an der Hofbegrünungsmaßnahme beteiligt“ zu sein; da wird nicht „verabsäumt, den jeweils Anderen ins Benehmen zu setzen“, sondern schlicht etwas verschwiegen. Wer das verinnerlicht hat, kann auch in der Pressestelle manch’ technokratischen Quatsch in verständliches Deutsch auflösen.Dafür habe ich in der Pressearbeit gelernt, wie sorgfältig man auf einzelne Wörter achten muss. Zum einen ist man viel näher an den Experten, die sich furchtbar aufregen, wenn etwas falsch gesendet oder gedruckt wird. Vor allem aber repräsentiert man die eigene Institution. Sprachliche Unschärfen können fatale Folgen haben. Deswegen haben Pressesprecher eine ungleich höhere Routine in der Rückvergewisserung und im Bemühen um Präzision.
Klar, ich bin selbst großer Verfechter der These, dass ein tagesaktuelles Massenmedium nun einmal kein Fachbuch ist und deswegen die Verständlichkeit deutlich vor der siebten Stelle hinter dem Komma kommt. Verständlichkeit und Präzision sind nun einmal keine Kumpels – und in der Kommunikation hat Verständlichkeit höchste Priorität. Aber ein klein wenig mehr Sorgfalt könnte manchem Journalisten durchaus gut tun, der schnell mal von der GmbH schreibt, wo dem Vorstand der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft im Nacken sitzt, oder von Kündigungen, wo lediglich Stellen nicht nachbesetzt werden, wenn jemand in Rente geht. Ich glaube, dass Pressesprechern die Wirkung oft bewusster ist, die eine falsche Berichterstattung haben kann. Das gilt noch viel mehr, wenn Menschen unmittelbar betroffen sind. Ob jemand nun Täter, Angeklagter oder Beschuldigter ist, das klingt vielen wie Erbsenzählerei. Für die Betroffenen und deren Angehörige liegen Welten dazwischen. Anderes Beispiel: Erst neulich erzählte eine Journalistin ganz selbstverständlich, sie habe einen Experten befragt, der einfach nicht gesagt hätte, was sie hören wollte. Es ging keineswegs darum, dass der Mann die Fragen ignoriert hätte, er gab nur nicht die erhoffte Antwort. Allerdings, erzählte die Journalistin zufrieden weiter, später sei es ihr doch noch gelungen, ihn dahin zu drängen. Vor lauter Begeisterung an der guten Geschichte geht aus meiner Sicht manchmal ein bisschen Respekt vor einzelnen Menschen verloren.
Vokabular muss zu den Rollen passen
Aber: Wer selbst mal in einer Redaktion gearbeitet hat, der weiß, wie ungeschickt viele Pressesprecher das Vokabular nutzen, dass das Verhältnis zwischen Journalismus und PR prägt. Da sollen Artikel platziert werden, auch wenn das alleine dem Redakteur zusteht, da werden Berichte gemailt, auch wenn es natürlich nur eine Pressemitteilung war. Die unterschiedlichen Rollen, also die beiden Seiten des Schreibtischs, dürfen auch im Vokabular nicht vermengt werden. Dazu gehört übrigens schon die umstrittene Frage, ob man als Pressesprecher die anwesenden Medienvertreter mit „Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen“ begrüßen darf.
Die Journalisten werden ihm diese Anrede vermutlich nicht durchgehen lassen, wenn er gegen grundlegende Regeln des Journalismus verstößt. Damit muss ich doch noch einmal auf das Schreiben und die Pressemitteilung zurückkommen. Ich könnte mich immer kaputtlachen, wenn eine Pressemitteilung mit einer Frage an den Journalisten beginnt: „Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob …?“ Nö, habe ich nicht. Werde ich auch nicht tun, denn ich möchte gerade die Meldungsspalte auf Seite neun füllen. Zack, Mail gelöscht. Was sollen die lustigen Bullet-Points über dem Fließtext? Warum brauche ich eine Dachzeile, eine Überschrift und noch drei, vier Unterzeilen? Warum werden einzelne Namen im Text unterstrichen? Was soll mit alledem passieren? Hier zeigt sich fehlendes Handwerkszeug, von dem der Pressesprecher hätte profitieren können.
Inzwischen sitze ich hauptberuflich gar nicht mehr an dem sprichwörtlichen Schreibtisch. Ich lehre an der Deutschen Presseakademie. Aus dieser Perspektive möchte ich noch zwei Beobachtungen zum Abschluss machen: Erstens erlebe ich in Seminaren und Studiengängen, wie sehr sich Pressesprecher bemühen, den Spagat zwischen bisweilen absurden Wünschen aus dem eigenen Haus mit den Anforderungen des Journalismus in Einklang zu bringen. Ich würde mir manchmal noch ein klein wenig mehr Mut zur Beratung wünschen. Das ändert nichts daran, dass die meisten redlich bemüht sind, nicht jeden Irrsinn ungefiltert an die Medien gelangen zu lassen. Das nimmt der Journalist in mir dankbar zur Kenntnis.
Für unsere Studierenden sind die Redaktionsbesuche während der Präsenzphasen immer wieder beeindruckend: Sie erleben dort, wie sehr die Medienleute bemüht sind, ihrem Publikum Tag für Tag das bestmögliche Produkt zu präsentieren. Das nötigt dem Pressesprecher in mir Respekt ab.
Es gibt also durchaus gute Gründe, warum diejenigen, die auf der anderen Seite des Schreibtischs arbeiten, Anerkennung und Verständnis verdient haben. Und was in beiden Berufen wichtig ist, auch wenn es nicht im klassischen Sinne zum Handwerkszeug zählt: Herzblut.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Geld. Das Heft können Sie hier bestellen.