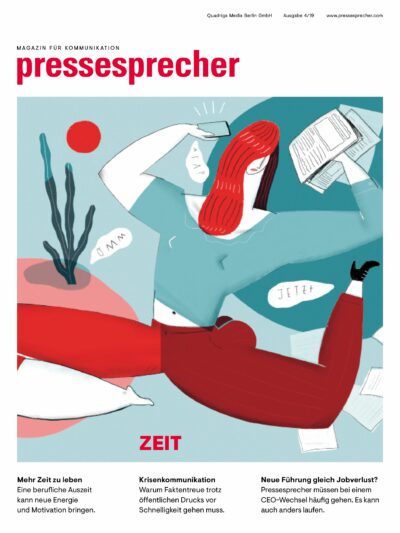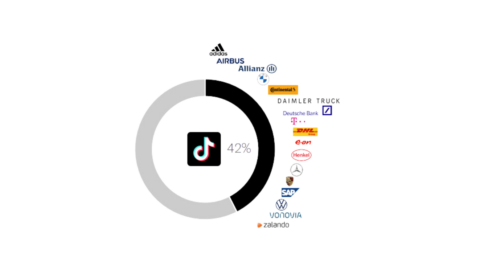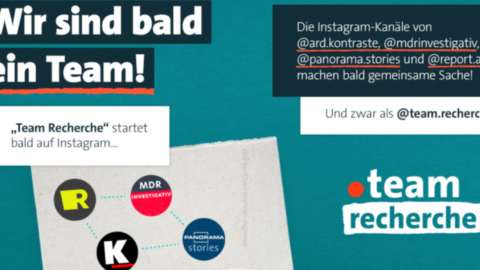Der technische Fortschritt der Informationsübertragung geht auf einen Zeitraum von etwa 200 Jahren zurück und die Übertragungskapazität wächst weiterhin exponentiell. Menschen senden und empfangen immer mehr Daten – vom Telefon über das Fernsehen bis hin zum Internet wird das Potenzial dieser Infrastruktur ständig erweitert.
Die Auswirkungen der ständigen Nachrichten-und Informationsflut auf unsere Aufmerksamkeit wurden in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Soziologen, Psychologen und Lehrer warnen, dass Eilmeldungen, Push-Benachrichtigungen sowie die Angst, etwas zu verpassen, zu einer „sozialen Beschleunigung“ führten. Bisher fehlten empirische Daten, um diese These zu untermauern. Ein Grund ist, dass langfristige Auswirkungen der Technologie auf die Gesellschaft erst jetzt, etwa 20 Jahre nach Entstehung des interaktiven Webs und dem Beginn der Datenerfassung auf Bevölkerungsebene, messbar sind.
Um besser zu verstehen, was die Welt bewegt, ist die Dynamik der sogenannten kollektiven Aufmerksamkeit, also des öffentlichen Interesses, eine interessante Beobachtungsgröße. Doch wie misst man kollektive Aufmerksamkeit?
In einem Team von Physikern, Mathematikern und Informatikern untersuchten wir in unserer Studie verschiedene Medien. Wir schauten uns an, wie lange ein Thema, ein Hashtag oder auch ein Film besonders beliebt waren. Die Daten dazu stammen aus Bestsellern der letzten 100 Jahre, aus Kinokartenverkäufen der letzten 40 Jahre, aus wissenschaftlichen Publikationen der letzten 25 Jahre sowie von Twitter, Google Trends, Reddit und Wikipedia aus verschiedenen Zeitspannen der 2010er-Jahre.
Spanne der kollektiven Aufmerksamkeit schrumpft
Besonders eindeutig lässt sich die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne anhand von Twitter ablesen. Aus einem Datensatz, der aus etwa 43 Milliarden Tweets besteht, gepostet zwischen 2013 und 2016, lesen wir ab, was die meisten schon spüren: Die Wellen der öffentlichen Aufmerksamkeit beschleunigen sich. Während ein Hashtag im Jahr 2013 im Durchschnitt noch für knapp 18 Stunden besonders beliebt ist, sind es drei Jahre später nur noch zwölf Stunden.
Twitter ist kein Einzelphänomen. Auch wenn man sich das Volumen einzelner Google-Suchbegriffe zu sogenannten populären Themen wie Sportmannschaften oder Politikern über die Jahre anschaut, wird klar: Die Zeitspanne, in der ein Begriff besonders oft gesucht oder ein Post auf Reddit stark diskutiert wird, wird immer kürzer.
Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf die Online-Welt. Anhand von Kinokasseneinnahmen analysierten wir, wie lange Kinofilme beliebt waren, und evaluierten mithilfe des digitalisierten Google-Books-Datensatzes, wie Themen von Buchautoren aufgegriffen und wieder fallen gelassen werden. So lagen in den Achtzigerjahren zwischen zwei Blockbustern in den Kinos durchschnittlich vier Monate, 2018 waren es gerade zwei Wochen. Bei zwei Büchern, die sich mit Trendthemen beschäftigten, lag im späten 19. Jahrhundert eine Zeitspanne von sechs Monaten, im 21. Jahrhundert war es gerade ein Monat.
In all diesen Datensätzen können wir ablesen, dass populäre Themen immer schneller auf Interesse stoßen und dieses zunimmt, zugleich aber auch schneller wieder abstürzt. Die dadurch kürzere Aufmerksamkeitsspanne hinterlässt jedoch keine Lücke, sondern wird sofort mit einer neuen Welle an Interesse für das nächste Thema gefüllt – die Zahl der Tweets zu populären Themen pro Woche hat sich zwischen den Jahren 2013 und 2016 von zwei auf vier Millionen verdoppelt. Das führt dazu, dass Mediennutzer mehr Themen in der gleichen Zeit aufnehmen und weniger Zeit für jedes einzelne Thema bleibt. Was heißt das nun für Kommunikatoren und Rezipienten?
Information frisst Aufmerksamkeit
„Information frisst Aufmerksamkeit“, sagte der Sozialwissenschaftler Herbert Simons bereits in den Siebzigerjahren: „Informationsreichtum schafft eine Armut der Aufmerksamkeit und die Notwendigkeit, diese Aufmerksamkeit effizient unter dem Überfluss an Informationen zu verteilen.“ Fast 50 Jahre später ist die menschliche Aufmerksamkeit in der vernetzten Welt zu einer knappen und wertvollen Ressource geworden. Simon‘s vereinfachtes Bild des Menschen als serielle Informationsverarbeitungseinheit macht diesen Zusammenhang klar:
Solange wir uns mit einem Inhalt beschäftigen, können wir uns keinem anderen widmen. Da Zeit für jeden Einzelnen nur endlich verfügbar ist, aber immer mehr Content produziert wird, entsteht ein Konkurrenzkampf. Produzenten und Konsumenten stehen gleichermaßen unter Druck – während beispielsweise Journalisten versuchen, die immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen der Konsumenten für ihre Themen zu gewinnen, wird es für den Einzelnen immer schwieriger zu entscheiden, welchen Informationen er folgen oder vertrauen kann.
Themen verpuffen schneller
Wohin mit dem Überfluss an Informationen? Schauen wir uns Twitter an: Hier führt das Mehr an Tweets nicht dazu, dass zum jeweiligen Thema vertieft getwittert wird. Eher führt es dazu, dass mehr Themen hintereinander aufploppen. Wir erklären diese Beobachtung damit, dass Content nicht nur schneller produziert wird, sondern durch globale Vernetzung auch früher beim Rezipienten ankommt. Dadurch verpufft Aufmerksamkeit für ein Thema schneller. Der Drang nach etwas Neuem treibt uns dann direkt zum nächsten Thema. Es entsteht ein Teufelskreislauf: Je schneller die Aufmerksamkeit aufgebraucht ist, desto aktueller müssen Kommunikatoren, Journalisten und Influencer neue Inhalte produzieren, was wieder zum schnelleren Saturieren führt.
Jeder Klick in der Aufmerksamkeitsökonomie ist bares Geld wert, weswegen Online-Anbieter die Nutzer auf ihre Plattform holen und sie dort halten wollen. Die Sortieralgorithmen von Newsfeeds haben oft starke Aktualitäts-Kriterien für die Reihenfolge der gezeigten Inhalte, um ihre Nutzer nicht zu langweilen. Das verstärkt den Druck noch zusätzlich und Inhalte müssen immer schneller und, im schlechtesten Fall, auch oberflächlicher recherchiert werden, um mithalten zu können.
Qualität vor Quantität
Die Geschwindigkeit der Datenübertragung wird weiterwachsen und die Methoden, unsere Aufmerksamkeit zu erzeugen, werden mit zunehmenden Informationen über unsere Vorlieben immer verlockender werden.
Es ist wichtiger denn je, mit neuen Formaten des Online-Publizierens zu experimentieren, die Gestaltung von News-Plattformen zu überdenken und Sortieralgorithmen zu überarbeiten. Einfache Kennzeichnungen von gut recherchiertem Content und leicht zugängliche Quellen über auffällige Links können helfen, andere Qualitäten als pure Aktualität und provokante Clickbaits im Online-Ökosystem zu belohnen. Wikipedia ist ein Beispiel dafür, wie aus der kollektiven Aufmerksamkeit kollektive Intelligenz werden kann. Die Gestaltung der Seite lädt ein, sich zu informieren, anstatt durchzueilen. Hier steht Wissen vor Neuigkeiten.
Im heutigen Informationszeitalter, in dem finanzielle und politische Macht zunehmend mit der Kontrolle über Aufmerksamkeitsströme verknüpft ist, sollten wir uns fragen: Wie können wir die Informationsflut besser nutzbar machen? Nur wer versteht, welche Gesetze unsere Gesellschaft in der Informationswelt befolgt, kann ihr Bildungs- und Vernetzungspotenzial voll ausschöpfen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe ZEIT. Das Heft können Sie hier bestellen.