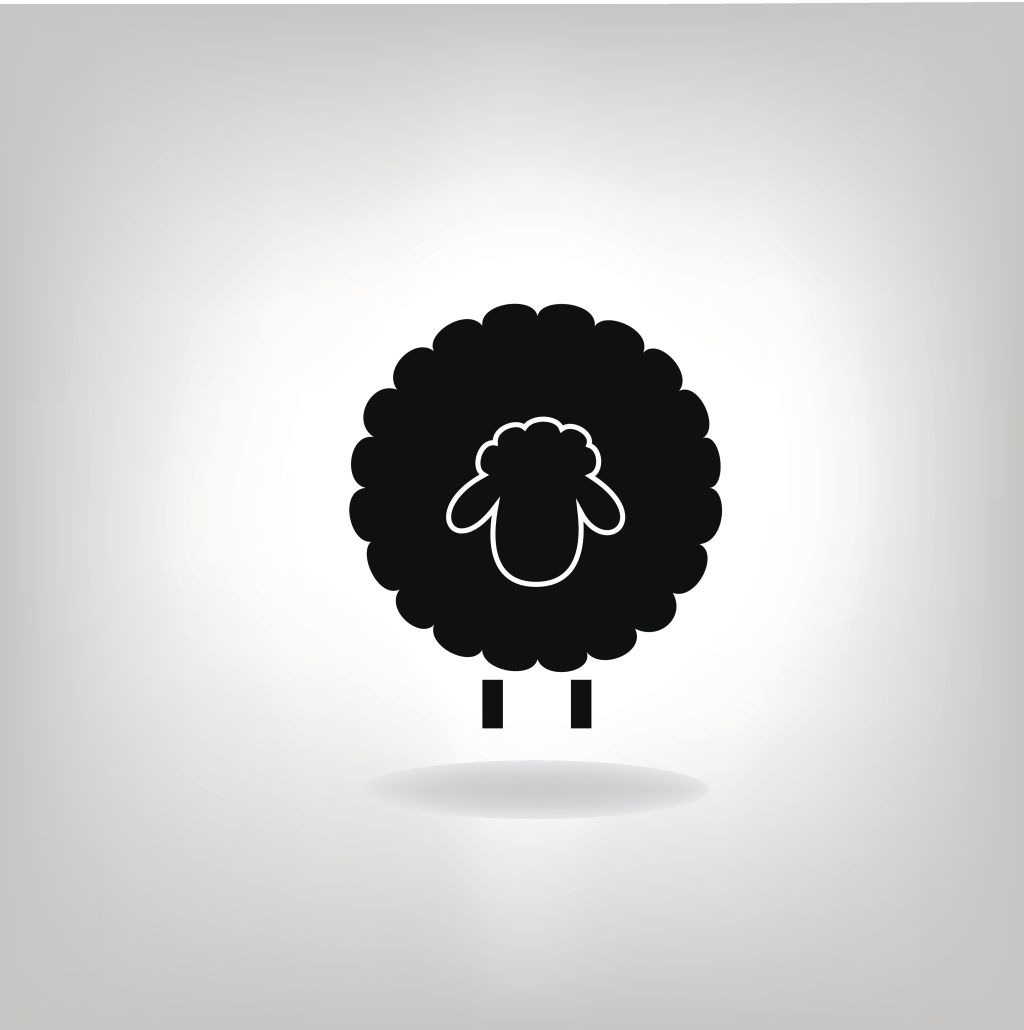Die ökonomische Krise der klassischen Medien hat sich inzwischen auch zu einer journalistischen Krise gemausert. Aus Kostengründen sind viele Redaktionen personell ausgedünnt worden, im Tagesgeschäft bleibt da kaum noch Zeit für Recherchen. Außerdem vergrößert sich ständig das Heer schlecht bezahlter freier Mitarbeiter in den Medien. Die Existenzängste sind gewaltig – wer will da schon die Erwartungshaltung der auftraggebenden Redaktion oder die Vorurteile von Lesern und Zuschauern enttäuschen, indem eingeräumt wird, dass an der Skandalgeschichte eigentlich nicht viel dran ist? Zumal ein solches Eingeständnis meist auch finanzielle Konsequenzen hat: Viele Redaktionen zahlen für derartig tot recherchierte Geschichten gar nichts oder nur ein mickriges Ausfallhonorar. Im Ringen um die wenigen festen Stellen, erinnert sich dann auch so manch freier Journalist an die alte Journalisten-Weisheit: „Wer schreibt, der bleibt!“
Aber auch die Festangestellten stehen heute unter zunehmendem Druck. Viele Verlage haben Zielvereinbarungssysteme aus der Industrie für ihre Führungskräfte und Redakteure übernommen. Einem Wirtschaftsjournalisten wird dann beispielsweise auferlegt, eine bestimmte Zahl von Exklusivmeldungen zu produzieren, die an Nachrichtenagenturen weitergegeben werden können. Diese verbreiten den Scoop dann mit Nennung der Quelle bundes- oder sogar weltweit. Das darauf einsetzende Medienecho wird wiederum gemessen und kann erneut Basis einer Zielvereinbarung sein – zum Beispiel für den Chefredakteur, zu dessen Aufgaben es gehört, für den journalistischen Ruhm seiner Zeitung oder Zeitschrift zu sorgen.
Journalisten mangelt es an Zeit
Wie bei jedem Zielsystem wird natürlich auch hier dem Glück etwas nachgeholfen. Journalisten nennen das „Zuspitzen“. Aus einem an sich harmlosen Zitat kann so ein Agenturknaller werden: „Die Reserven der Allianz haben sich halbiert“ – diese Meldung geisterte vor Jahren einmal durch die Presse. Dass dies überhaupt kein Grund zur Panik war, weil das finanzielle Polster des Versicherers noch immer weit überdurchschnittlich ausfiel und die Altersversorgung seiner Kunden zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, hatten die Leser des Original-Interviews noch mitbekommen. In der journalistischen Weiterverwertung wurde dieser Hintergrund immer weiter zusammengekürzt, bis nur noch die Schlagzeile übrigblieb. Die richtige Meldung ist das eine. Die richtige Einordnung derselben ist das andere. Beides sind wichtige Aufgaben des Journalismus, denen nicht immer nachgekommen wird.
Außerdem knirscht es zunehmend in der Kommunikation zwischen Journalisten und Pressesprechern. Beide kreisen zwar auf der beruflichen Ebene permanent umeinander, sie kommen aber aus zwei verschiedenen Welten. Das hat viel mit der Organisation des Alltags zu tun: So werden in einer Redaktion Entscheidungen meist auf Zuruf zwischen einigen wenigen getroffen. Viele Detailfragen zu seinem Beitrag klärt der Journalist sogar mit nur einer Person – sich selbst. Anders könnten tagesaktuelle Medien auch gar nicht produziert werden. Schließlich müssen gewaltige Mengen Stoff zum Redaktionsschluss, pünktlich aufbereitet und ausgeliefert werden. Das gelingt nur, wenn die handelnden Akteure ihre Arbeit weitgehend selbst gestalten und über die Inhalte selbst entscheiden können.
Pressesprecher treffen auf Unverständnis
Deswegen sind Journalisten oft erstaunt, wie langwierig Abstimmungsprozesse in einem Unternehmen sein können und dass ein Pressesprecher nicht mal eben seinen Vorstand oder einen Experten herbeizitieren kann. Sie übersehen dabei, dass die Tagesabläufe von Top-Managern oft minutiös durchgetaktet sind. Gerade in großen Konzernen mit teilweise mehreren hunderttausend Mitarbeitern sind zudem die nationalen und internationalen Berichtswege und Entscheidungsprozesse hochkomplex. „Wenn der Daimler wüsste, was der Daimler alles weiß“ – das gilt nicht nur bei dem schwäbischen Hersteller von Kraftfahrzeugen. Da dauert alles etwas länger – sowohl das Finden der richtigen Fakten und kompetenten Ansprechpartner. Entscheidungen ziehen sich besonders lange. Insbesondere wenn es heikel wird (was bei Anfragen von Journalisten häufig der Fall ist), wird gerne langwierig an einer einheitlichen Antwortformel gefeilt.
Gemessen daran sind fast alle Tageszeitungen und Sendeanstalten eine Art Kleinbetriebe, in denen sich zudem alles nur um ein Produkt dreht – die Information. Darauf sind sämtliche Arbeitsprozesse abgestellt und trotz einer insgesamt hohen zeitlichen Belastung finden sich im Alltag eines Journalisten genügend Freiräume, um flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren. In einem Industriebetrieb hingegen gehört die Kommunikation, insbesondere die zu den Medien, zu den Nebenbeschäftigungen eines Managers – zu den ungeliebten meistens. Was dies bedeutet, ist für Journalisten schwer zu verstehen, weil er den Mikrokosmos seiner Redaktion unbewusst auf jedes andere Unternehmen überträgt. Die Innenwelt einer Firma kennt der Journalist aber oft nur von einigen Stunden Betriebsbesichtigung während einer Pressereise. Kommt zum prinzipiellen Unverständnis dann noch ein aktuelles Missverständnis, ist der kommunikative Brei für eine schlechte Story schnell angerührt.