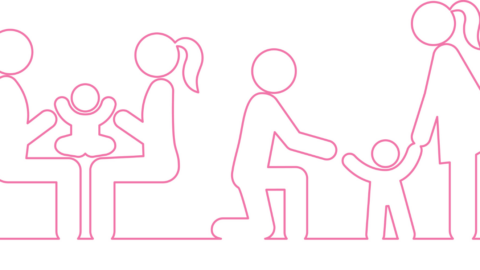Mit Frank Behrendt ein Interview zu führen, ist eine sehr angenehme Sache. Der gestandene PR-Profi wirkt nahbar und vermittelt im Gespräch eine Entspanntheit, die man nicht unbedingt von einem der bekanntesten Köpfe aus der Agenturwelt erwartet hätte. Doch schon nach wenigen Augenblicken fühlt sich das völlig selbstverständlich an.
Herr Behrendt, wie viele Stunden arbeiten Sie im Moment am Tag?
Frank Behrendt: Das weiß ich gar nicht. Ich zähle das ja nicht. (lacht) Zehn wahrscheinlich.
Ist das gefühlt mehr oder weniger geworden in den vergangenen Jahren?
Da ist eine gute Frage. Gefühlt ist es wahrscheinlich weniger geworden durch eine höhere Effizienz.
Ist die Arbeit heute leichter zu bewältigen?
Ich bin ja nun schon seit vielen Jahren im Berufsleben und habe unterschiedliche Arten und Weisen zu arbeiten kennengelernt. Ich bin zu einer Zeit ins Arbeitsleben eingestiegen, als es noch keine Smartphones und mobilen Computer gab. Man saß da in der Tat angeschraubt am Schreibtisch und konnte gar nicht woanders arbeiten als im Büro. Heute kann ich deutlich flexibler arbeiten – auch an Orten wie der Basketballhalle meines Sohnes, beim Ballett meiner Tochter, abends zuhause oder wenn ich am Rheinufer mit dem Hund unterwegs bin. Oft bekomme ich in entspannter Atmosphäre auch viel schneller Einfälle und gute Ideen, als wenn ich vor dem Computer im Büro sitze. Durch die Flexibilisierung und die Technik hat sich die Art zu arbeiten geändert. Auch wenn ich danach weiter arbeite, ist dieses Gefühl, um sieben mit meiner Familie zusammen am Abendbrottisch zu sitzen, ein ganz wertvolles, was ich wahrscheinlich überdurchschnittlich als Freizeit erlebe. Und ich mache inzwischen anders Pausen – vier Mal 15 Minuten statt einmal eine Stunde. Diese 15 Minuten – ohne Smartphone – sind für mich aber wie vier Mal 30 Minuten. Also habe ich gefühlt doppelt so lange Pause als tatsächlich.
Haben Sie einen typischen Tagesablauf?
Nein, aber es gibt bestimmte Muster, die sich wiederholen. Bei mir kommen diese aber hauptsächlich aus dem privaten Bereich – wie zum Beispiel die Anfangszeiten der Schule. Wenn meine beiden kleinen Kinder um 8:10 Uhr in die Schule gehen, dann richtet sich natürlich mein Tageablauf nach diesen Bringzeiten. Genauso wie die Kinder irgendwann Feierabend haben. Das sind Eckpfeiler, um die sich der Job dann herumrankt. Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, dann buche ich beispielsweise Flüge so, dass ich um 9:30 Uhr eine Maschine erwischen kann. Das heißt aber auch, dass ich in der Regel Termine heute anders gestalte als früher. Das ist am Ende eine Frage der Absprache. Man muss nicht alle Termine nehmen, wie sie reinkommen. Auf der Gegenseite sitzen auch Menschen und mit denen kann man reden. Dann kriegt man Termine auch so getaktet, dass sie zum Leben passen und nicht das Leben zu den Terminen passen muss.
Da sind wir dann auch schon beim Thema. Sie plädieren in Ihrem Buch „Liebe dein Leben und nicht deinen Job“ für einen gelassenen Umgang mit der Arbeitswelt. Wie kamen Sie dazu?
Ich bin wie viele andere auch in die Falle getappt, dass der Berufsalltag Herr über mein Leben geworden ist. Ich habe dadurch meine damalige Beziehung, meine Familie und auch mich selbst so belastet, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich das nicht mehr mit mir machen lasse. Dann gab es einen persönlichen Change-Prozess. Aber, das muss ich fairer Weise sagen, eben getrieben durch eine Negativerfahrung. Ich glaube im Handelsblatt hat mal jemand geschrieben, dass „Herr Behrendt seine erste Ehe auf dem Altar der Karriere geopfert hat“. Das ist gar keine so schlechte Beschreibung. Mit Ende 20 – ich war relativ früh schon in Verantwortung – habe die Dinge doch anders gesehen und gemacht als ich es heute mit Abstand betrachtet tun würde. Heute gebe ich mein Wissen weiter. Damals wäre ich froh gewesen, hätte ich jemanden wie Herrn Behrendt gehabt, der mir das Buch vor 20 Jahren in die Hand gedrückt hätte. Ich glaube, dann hätte ich einiges anders gemacht.
Wie haben Sie den Weg gefunden zu mehr Gelassenheit?
Ich habe mich mit meinem damaligen Setup und dem Scheitern meiner Ehe selbstverständlich nicht sonderlich wohl gefühlt und habe mich dann mit einem Coach zusammengesetzt. Das würde ich auch jedem anderen raten. Man kommt selten aus solchen Problemsituationen heraus, indem man das nur mit sich selber klärt oder mit guten Freunden und dem Partner spricht. Der ist ja selbst Betroffener. Man braucht eine neutrale Person, der man die Situation darlegen kann. Ich habe mich zusammen mit Bertold Ulsamer auf eine Almwiese gesetzt. Wir haben einfach mal ein, zwei Tage abseits des Alltages resümiert: das bisherige Leben, die Erwartungshaltung, die Fehler und was ich gerne anders machen möchte. Und dann habe ich mit Hilfe des Coaches einen Masterplan aufgestellt. Die hohe Kunst ist es, diesen auch wirklich zu exekutieren – im Privatleben mit der gleichen Konsequenz, wie man es im Berufsleben zwangsläufig macht.
War das Ganze ein schmerzhafter Prozess?
Ja, aber am Ende ein sehr glücksstiftender. „Nein“ ist ein Zauberwort in diesem Prozess. Durch ein „Nein“ macht man bestimmte Dinge einfach anders als vorher und sucht bewusst neue Wege. Das heißt eben auch mal Abendessen und bestimmte Terminen abzusagen. Man muss nicht auf jeder Abendveranstaltung sein. Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Wobei, schmerzhaft würde ich gar nicht so sagen, sondern einfach anstrengend, weil man es vielen Leuten erklären muss, weil man das argumentieren muss. Ja zu sagen bedeutet, keine Probleme zu haben, keine Widerstände.
Mussten Sie sich Vorwürfen stellen, dass Sie für die Agenturarbeit nicht gemacht sind, nicht hart genug sind?
Das so jetzt nicht, denn ich habe ja dennoch zuverlässig Erfolge produziert. Aber ich musste mich immer Vorwürfen stellen, auch jetzt bei dem Buch und den Thesen, ich würde die Arbeit nicht ernst nehmen, weil ich von Monopoly für Erwachsene rede. Dienstleister zu sein, hieße doch, immer da zu sein. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Interpretationsweisen. Und ich glaube, dass meine Haltung, meine Art und Weise zu denken und zu arbeiten ja in keinster Weise konterkariert, dass ich nicht trotzdem ein hochprofessioneller Dienstleister bin, der als Agenturmensch ja auch eine Top-Performance abliefert. Nur eben in einem Rhythmus, den ich bestimme. Dass ich Dirigent meines Lebens bin, heißt nicht, dass ich weniger arbeite. Ich nehme mir nur die Freiheit, während des Arbeitstages Freizeit hineinzudefinieren, wenn es in mein Leben passt. Aber natürlich gab es bei einer so steilen These „Lebe dein Leben, aber nicht deinen Job“ auch die Vorwürfe: „Der Behrendt liebt seinen Job ja gar nicht. Wer seinen Job nicht liebt, kann ihn nicht gut machen“. Das heißt aber nur, dass die Leute das Buch nicht zu Ende gelesen und verstanden haben. Aber der Titel war natürlich auch eine Provokation, um den Verkauf zu steigern. Dafür ist man schließlich PR-Manager (lacht).
Haben wir aus Ihrer Sicht ein Problem im Umgang mit unserem Job?
Wir haben das Problem, dass viele Vorgesetzte und Unternehmensstrukturen lange Jahre ein bestimmtes Bild gezeichnet haben, wie eine Karriere auszusehen hat. Erst muss man sich rund um die Uhr hocharbeiten, um dann irgendwann im Alter die Früchte zu ernten. „Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre“, sagte man oft und gerne. Das ist ein tradiertes Rollenbild, das aus einer anderen Zeit stammt, wo man natürlich mit Leistung und Arbeit etwas erreicht hat. Aber heute ist es ja auch nicht so, dass man mit Nicht-Leistung und Nicht-Einsatz irgendetwas erreicht. Nur haben die heutigen Generationen andere Ansprüche an ihr Gesamtpaket aus Leben und Arbeit. Natürlich wollen sie einen sinnhaften Job haben und Geld verdienen, aber sie möchten im Gegenzug auch in gleichen Teilen mit den Freunden und Partnern zusammen sein und am Leben teilnehmen. Ich persönlich glaube, obwohl ich nicht der Generation Y oder Z angehöre, dass man einen guten Job machen und trotzdem am Leben teilnehmen kann. Natürlich wird es immer Berufe geben, in denen man nicht so flexibel arbeiten kann, aber im normalen Business, in dem ich mich ja auch bewege, ist die Arbeitsmethodik nicht mehr an einen Nine-to-Six-Job gebunden, sondern deutlich flexibler. Und ich glaube, ich habe mit meinen Thesen einen Nerv getroffen. Die Leute sehnen sich nach solchen Modellen. Da ist mein Ansatz sicherlich eine Anregung, über den eigenen Status Quo nachzudenken.
Man kann aber die Möglichkeiten der digitalen Revolution auch als Mittel sehen, immer präsent im Leben der Mitarbeiter zu sein und den Arbeitsdruck hoch zu halten, allein dadurch, dass man jederzeit arbeiten, jederzeit antworten kann und eben nicht nur, wenn man am Schreibtisch sitzt.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Wir können jetzt Arbeitszeit anders gestalten und an Orten arbeiten, wo man früher nicht einmal drüber nachdenken konnte. Andererseits ist diese permanente Erreichbarkeit etwas, mit dem man umgehen können muss. Es geht gar nicht darum, ob Unternehmen gezwungen werden, am Wochenende keine Mails zu schicken. Jeder Einzelne – das ist mein Plädoyer – muss für sich persönlich die Entscheidung treffen, wann er erreichbar ist und wann nicht. Hier müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfach mehr kommunizieren. Wann kann ich was machen. Führer war man nicht erreichbar, wenn man auf Reisen im Flugzeug saß. Heute gibt es im Flugzeug WLAN. Das heißt, je erreichbarer die Technik uns macht, umso mehr müssen wir in der Lage sein, selber den Ausknopf zu bedienen. Am Ende des Tages geht es nur um eine klare Kommunikation, wann Arbeitspakete erledigt werden müssen – und auch da helfen uns heute viele Tools im Bereich des Projektmanagements. Wenn Sie sich amerikanische Unternehmen wie Zappos und andere anschauen, da gibt es ja gar keine Führungsstrukturen mehr. Die Leute arbeiten mit temporären Projekt-Leadern in ihren Workgroups und leisten ihre Arbeit dann, wann sie es für richtig halten. Hauptsache es geschieht termingerecht. Nur so so kann man ja auch bei internationalen Projekten zusammenarbeiten. Man kann sich von Leuten im Silicon Valley einiges abgucken. Wenn man dabei nicht vergisst, an seinem Leben teilzunehmen, dann hat man genau diesen Mix zwischen Leben und Arbeit, bei dem auch die Digitalisierung nicht bedrohlich, sondern eigentlich eher unterstützend ist.
Sie sind auch sehr viel auf Twitter unterwegs. Das ist doch auch wieder etwas, das unsere Aufmerksamkeit vehement einfordert. Können Sie sich davon freimachen?
Ja, das geht. Ich verordne mir sogar selber entsprechende Detox-Pausen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das selbstgewählt ist. Ich nutze die sozialen Netzwerke to go. Ich setze mich ja nicht hin und bin eine Stunde auf Twitter, sondern wenn ich irgendwo etwas sehe oder mache, dann poste ich das. Und das ist auch etwas, was ich mit der Gelassenheit meine. Es ist ein Irrglaube, dass man irgendetwas verpassen würde. Das Tolle ist ja, auch wenn Sie mal eine Stunde nicht auf Twitter oder Facebook sind, dreht sich die Welt trotzdem weiter und alle Freunde sind noch da. Netzwerke sind für mich wie so ein elektronisches Tagebuch, eine Art Poesiealbum von verschiedensten Dingen und natürlich auch Informationen. Deswegen empfinde ich es in keinster Weise als Stress. Wenn es mir so ginge, würde ich sofort damit aufhören.
So wie Sie es beschreiben, klingt es sehr danach, Autonomie über die eigene Zeit, das eigene Handeln zu bekommen. Steht es nicht zu befürchten, dass wir durch die fortschreitende Digitalisierung eigentlich immer mehr und mehr getrieben sind von Maschinen und Software, die unseren Arbeitsrhythmus bestimmen, so wie es in der Produktion ja in weiten Teilen schon Realität ist?
Es kommt einfach darauf an, ob man das mit sich machen lässt. Auch ich kann mir die Welt nicht so machen, wie sie mir gefällt. Auch ich habe im Dienstleistungsbereich Kunden und Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, wie Flugpläne zum Beispiel oder Bahnzeiten. Man darf ja eines nicht vergessen, viele Dinge sind statisch. Man hat aber Korridore.
Korridore?
Ja. Es geht bei diesen Sorgen oft darum, dass sich Menschen fremdbestimmt fühlen und glauben, nichts selbst entscheiden können. Wenn ich mir aber zehn Prozent Selbstbestimmung freimache – beispielsweise die Mittagspause oder in bestimmten Randzeiten – macht das schon einen riesen Mehrwert aus. Und auch diese Angst. Wir sind ohnehin eine sehr angstgetriebene Gesellschaft. Wir sollten aber keine Angst haben, dass uns Roboter irgendetwas diktieren. Natürlich gibt es Technologien, die einen Reminder schicken, damit die Dinge einfach in einem Flow gehalten werden. Aber das war früher doch nicht anders. Da kam eben der Vorarbeiter oder der Chef rein und sagte: „Mein Lieber Sven, du musst bis morgen um 13 Uhr etwas abliefern.“ Dass das jetzt eine Technologie macht, ist nicht total furchteinflößend. Aber ich glaube, hierbei wird oft auch getan, als ob die Digitalisierung etwas komplett aus dem Science Fiction wäre.
Ist sie aber nicht?
Nein, am Ende des Tages ist die Digitalisierung nur die Technisierung von Workflows, von Prozessabläufen. Wenn man sich anschaut, wie die Leute früher Häuser gebaut haben, da gab es auch Prozesse, vom Fundament bis hin zum Richtfest. Da hat kein Digitalprogramm genervt, der Polier mit dem Bauplan in der Hand hat Ansagen gemacht. Man muss die Technik nicht als etwas Neues sehen, eher als etwas anderes. Aber auch die Maschine hat irgendjemand programmiert. Es wird viel Wind gemacht, und Angst projiziert, die eigentlich völlig unbegründet ist. Ich empfehle immer ein bisschen die Denke von Justus Jonas von den Drei Fragezeichen, meiner Lieblingshörspielserie. Hinter als den Phänomenen in der Serie, hinter diesen vermeintlichen bedrohlichen Geschichten steckt oft gar nicht so viel Zauber. Auch in Zukunft werden Menschen gebraucht werden, nicht nur Roboter. Wenn sie irgendwann nicht mehr als Arbeitskräfte für Standardtätigkeiten gebraucht werden, ist das dennoch kein Verlust. Es gibt genug andere Tätigkeiten, viele entstehen gerade oder werden entstehen. Und die müssen ja nicht schlechter sein als die jetzigen.
Welchen Umgang mit der Arbeit würden Sie empfehlen?
Erst einmal geht es um die Haltung. Man muss sich entscheiden, was man eigentlich persönlich will. Macht Euch nicht nur Euren Karriereplan. Macht Euch auch einen Plan, wie Ihr Euer Leben leben wollt! Wie soll Euer Leben stattfinden? Was sind Eure Interessen, was sind die Dinge, die Euch wichtig sind? Welche Urlaube möchte Ihr machen, welche Eurer Träume sind unerfüllt?
Diese Sehnsucht nach Sabbaticals und ähnliche Thematiken kommt nicht nur, weil die Leute eine Auszeit von der Arbeit brauchen. Sie haben einfach Lust auf Erfahrungen und Inspirationen. Wir haben heute die Möglichkeit, die ganze Welt recht unproblematisch zu bereisen und zu erfahren. Das nützt am Ende auch den Unternehmen. Für das Leben ist das Zusammensein mit Menschen eben oft wichtiger als der Job. Zumindest ist es bei mir so und bei denen, die ich kenne. Wenn sich Leute nur über den Job definieren, sind das oft diejenigen, die gefährdet sind, irgendwann daran zu zerbrechen oder krank zu werden. Dieser Mehrklang – Menschen, Job, Digital – ist wichtig. Es wäre völlig falsch zu sagen, macht euch frei vom Digitalen. Es ist nun mal da und es wird auch nicht mehr weggehen. Das ist ein Faktum. Man muss sich damit beschäftigen. Selbst ich als Dino bin die Netzwerke eingestiegen und außer snapchat habe ich alles verstanden. (lacht)
Ja, damit sind Sie nicht alleine.
Viele Technologien lohnen, sich mit ihnen zu beschäftigen – aber auf spielerische Art und Weise. Wir sollten sie nicht als Bedrohung, sondern als Spaß und nützliche Hilfsmitte sehen. Nichts davon ist furchteinflößend. Auch in den vergangenen Jahrhunderten gab es oft genug große Revolutionen. Die waren nur vielleicht nicht so dynamisch wie jetzt die digitale Revolution. Ich war damals in der Musikbranche, als Downloads die Vinylplatte und letztendlich auch die CD gekillt haben. Die Zeit haben wir auch überlebt. Früher hatten wir Kassetten, jetzt haben wir den Stream. Deswegen ist aber das Hörspiel ja nicht schlechter.
Man muss auch etwas mehr Gelassenheit und Logik an den Tag legen. Ich finde, Angst ist kein guter Begleiter, um die Zukunft zu verstehen. Und die ist gar nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wird. Natürlich gibt es Märkte, Faktoren, Politiker oder andere Kameraden, die einem das Leben nicht gerade leichter machen, aber ansonsten ist alles meistens erleichternder. Wie oft haben wir früher stundenlang am Kopierer hin und her kopiert oder uns ewig in Ämtern angestellt. Vieles bringt uns mehr Zeit für das Leben, und es ist unsere Aufgabe, aus diesem Geschenk an mehr Freizeit auch mehr zu machen. Wenn ich irgendwo anders Zeit spare, heißt das nicht, dass ich deswegen noch mehr arbeiten muss. Das ist unsere eigene Entscheidung.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie würden sich ernst, aber nicht wichtig nehmen. Können Sie mir das an einem Beispiel erläutern?
Am Ende des Tages geht es darum, auch mal über sich lachen zu können und sich nicht so bierernst zu nehmen. Wenn ich von einer Youtuberin eine Gesichtscreme bekomme, dann probiere ich die abends auch mal aus und poste ein Foto. Wenn ich bei Winnetou mitspiele, ist es mir egal, wenn Leute sich fragen, ob jemand wie ich es sich leisten kann, als Kleindarsteller in einem RTL-Film mitspielzuspielen. Mich kümmert es nicht, was andere Leute denken. Wie hat Udo Lindenberg gesungen, ich mache mein Ding, ganz egal, was die anderen labern.
Wir arbeiten in einer spannenden Branche. Aber die Kommunikationsbranche ist keine, die Leben rettet, oder die Welt verändert. Das muss man sich immer mal wieder klar machen. Wir lösen nicht den Hunger der Welt und heilen Krankheiten, sondern wir können helfen, Dinge besser zu kommunizieren. Das ist sicherlich ehrenvoll, aber es ist nichts, wo man jeden Tag in Trübsal und schwerwiegende Themen versinken muss. Man sollte eine gewisse Leichtigkeit auch mit sich selber haben: Du bist ein Agenturmensch, ein Kommunikator, aber nicht der Nabel der Welt. Es hilft immer auch über sich selber zu lachen, über seine Schwächen, seine Marotten.
Gerieben hat man sich ja auch ganz gerne an dem Punkt, wie Gelassenheit mit der Agenturwelt zusammenpassen soll. Sie haben es angesprochen. Ist in dem Geschäft in den vergangenen Jahren mehr Flexibilität eingekehrt, oder ist es gar noch dichter geworden?
Da wird auch viel Hokuspokus erzählt. Ein Pitch war immer ein Pitch und wir haben auch damals am Wochenende gerödelt. Früher war das noch viel anstrengender, weil die ganzen Booklets gemacht werden mussten. Da ist das heute entspannt dagegen. Was gab es für analoge Tätigkeiten, bei denen ganze Bataillone von Mitarbeitern nächtelang irgendwas geschraubt haben, was heute mit drei Klicks erledigt ist? Natürlich gibt es Leute die möglichst schnell pitchen wollen. Aber die gab es früher auch schon. Es ist natürlich insofern fordernder geworden, dass man immer in 360 Grad die Aufgaben komplexer lösen und Multi-Kanal denken muss. Aber das ist ja auch spannend. Ich halte es nicht für einen Nachteil. Und ich habe auch nie gesagt, dass ich mit meiner Haltung um sechs Uhr fröhlich pfeifend nach Hause gehe, wenn ein Pitch da ist. Ich bin der erste, der mit den Leuten genauso abends Dinge vorbereitet, wenn es sein muss. Das hat nichts damit zu tun, dass man in Ausnahmesituationen natürlich auch mal ranklotzt. Keine Regel ohne Ausnahme. Wichtig ist nur, dass es kein Dauerzustand ist. Lange im Büro sitzen ist kein Indikator für Fleiß und Performance. Im Gegenteil, die Leute, die früher auch mal einen Cut machen und sich inspirieren lassen, sind morgens viel frischer und arbeiten besser.
Zu der Zeit, als sie in die Agenturwelt eingestiegen sind, wäre da ein Chef denkbar gewesen, der seinen Mitarbeitern mehr Gelassenheit empfiehlt?
Das wäre eine interessante These gewesen. Aber es gab schon solche Typologien. Mein früher Chef bei Stein Promotions in den 80er Jahren hat das auch schon vorgelebt. Ich glaube, vieles, das ich übernommen habe, habe ich mir auch von Leuten abgeguckt. Man hatte nicht so die Möglichkeiten, Freiraum zu geben, weil es die Technik nicht gab. Da war die physische Präsenz ganz einfach verordnet. Aber ich persönlich glaube, die Zeit war damals noch nicht reif. Man kam aus einer anderen Entwicklung. Man hatte letztendlich auch von Vorbildern gelernt, die sich alles in der Nachkriegsgeneration hart erarbeitet hatten. Damals war es hoch erstrebenswert, ein schickes Auto und ein eigenes Familienhäuschen zu haben. Bausparverträge waren ein Riesenthema. Fragen Sie heute mal einen 18-Jährigen, ob für ihn ein eigenes Auto und ein Bausparvertrag wirklich wichtig sind. Der lacht Sie aus.
Wir leben jetzt in einer Zeit, in der die ersten Leute in Chefpositionen sind, die gelernt haben, dass man auch ohne diesen Grad an körperlicher Art mit neuen Geschäftsmodellen viel Geld verdienen kann – das ganze Startup-Thema zum Beispiel. Damals, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wäre das in in der Tat ungewöhnlich. Wenn Sie sich vorstellen: Frank Behrendts Thesen 1975 – ich glaube, das hätte einen Granateneinschlag gegeben. Es wäre vielleicht ein cooler Stunt gewesen, aber es wäre in der Breite auf völliges Unverständnis gestoßen, weil die Zeit überhaupt nicht reif dafür war.
Als Sie zum Jahreswechsel nach sechs Jahren FischerAppelt verlassen haben, sah das von außen betrachtet eher nach Downshifting aus. Einfach mal etwas anderes machen. Jetzt sind Sie bei Serviceplan. Lieben Sie die Agenturarbeit doch so sehr?
Lieben tue ich ja erst einmal gar keine Arbeit, sondern mein Leben (lacht). Ich arbeite gerne und ich habe immer schon gerne gearbeitet. Hier ist einfach auch viel fehlinterpretiert worden. Ich habe ja immer betont, dass ich auch andere Dinge machen möchte. Und daran hat sich heute nichts geändert. Das war auch der Grund, warum ich bei FischerAppelt vom Vorstand zum Senior Advisor gewechselt bin. Und das war auch eine Einstellungsvoraussetzung bei Serviceplan. Ich schreibe an meinem zweiten Buch, bin auf Veranstaltungen und viel als Vortragsredner unterwegs – das macht mir sehr viel Spaß. Ich wollte ja gar nicht aus dieser Branche weg, sondern nur ein Setup haben, wo ich nicht mehr alleine für einen großen Bereich sehr operativ als Manager verantwortlich bin. Ich mag es sehr zu pitchen, bin gerne mit jungen Leuten zusammen und habe Spaß an der Kundenberatung. Ich bin nach wie vor gerne auf dem Spielfeld. Ich wäre ja auch verrückt, wenn ich meine Bekanntheit, die ich mir ja auch mühsam aufgebaut habe, nicht kapitalisieren würde. Und es war auch klar, dass ich durch das Buch und die Thesen sicherlich in unserer Branche eine gewisse Popularität erfahren habe. Das ist dem Business zuträglich. Ich mag meinen Beruf. Auch wenn ich ihn nicht liebe, ist es etwas, das ich mit großer Leidenschaft und Spaß ausübe.