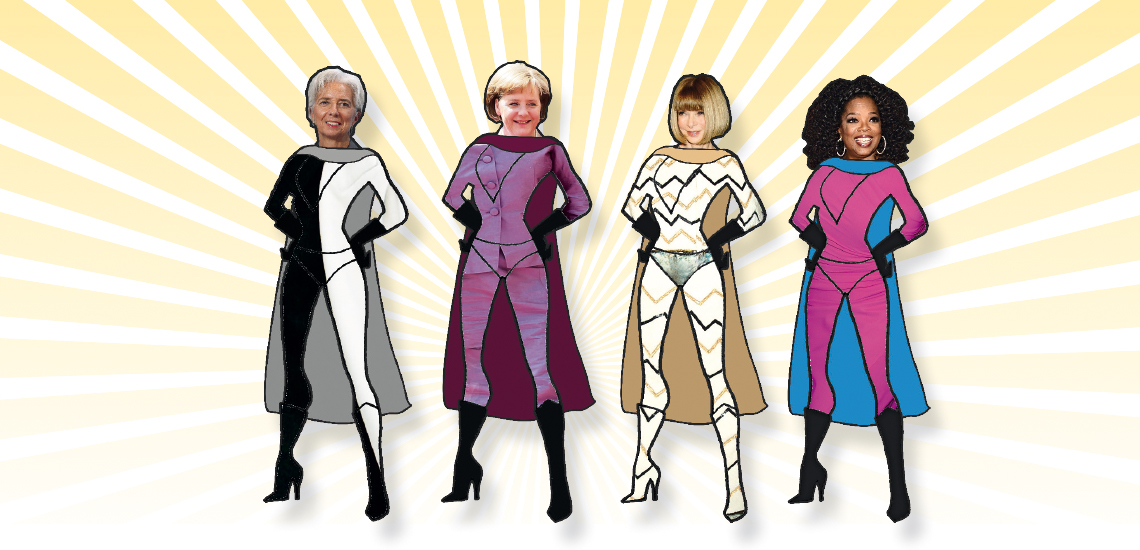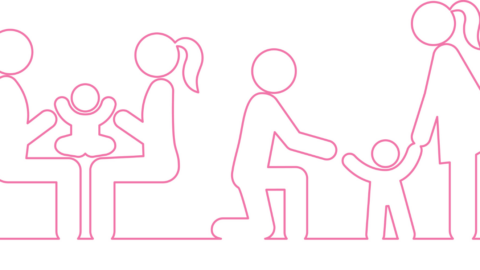Frau Bauer-Jelinek, was verstehen Sie unter dem oft diffusen Begriff der Macht?
Christine Bauer-Jelinek: Ich verstehe Macht zunächst einmal als das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Diese Definition ist nah an der von Max Weber, nur dass dieser noch die Gewalt mit hineindefiniert. Darauf verzichte ich im Hinblick auf die feineren Nuancen des Begriffs.
Viele denken an Gier und Herrschsucht, wenn Sie das Wort hören. Warum ist das Thema so negativ besetzt?
Macht hat vor allem in Deutschland und Österreich, den Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs, einen extrem negativen Beigeschmack, beinahe etwas Anrüchiges. Hier wird der Begriff sehr vorsichtig verwendet. Wenn man mit Franzosen oder Italienern spricht, ist das etwas völlig anderes. Und gerade bei US-Amerikanern wird das Wort „Power“ – egal ob im Zusammenhang mit einem Fitnessstudio oder dem Weißen Haus – absolut locker verwendet. In den vergangenen zehn Jahren ist das Thema aber auch bei uns mehr in die Öffentlichkeit gelangt. Das Verständnis von Macht hängt sehr stark von der Nationalität ab – und vom Geschlecht.
Inwiefern?
Männer haben ein positiveres Verständnis von Macht, Frauen sind hier noch reservierter. Das liegt an tradierten Rollenbildern, aber auch an einem biologischen Faktor: Östrogene sorgen für ein anderes Verhältnis zur Macht als Testosteron. Solche Argumente gelten meist als politisch nicht korrekt, aber es gibt gute Untersuchungen, die belegen, dass unter stärkerem Einfluss dieses Hormons das positive Konkurrenzverhalten zunimmt. Ich möchte aber betonen: Die Biologie bietet Chancen, doch sie zwingt zu nichts. Man kann nahezu alles ausgleichen. Dennoch sollten wir uns mit biologischen Ausgangssituationen auseinandersetzen.
Im Jahr 2009 haben Sie ein Buch mit dem Titel „Die dunkle und die helle Seite der Macht“ veröffentlicht. Was kann man sich darunter vorstellen?
Die finstere Seite umfasst alles, was wir als Machtmissbrauch verstehen. Die Medien können einem manchmal das Bild vermitteln, Macht wäre weltweit immer mit Gewalt und Korruption verbunden. Ich wollte die helle Seite dagegensetzen, als Gestaltungsmacht, die jeder Mensch im Leben braucht, immer dann, wenn er sich gegen Widerstände durchsetzen möchte – sowohl im Alltag, beispielsweise im Umgang mit den Kindern, als auch in der Karriere. Mit ausschließlich negativen Bildern im Kopf können wir nicht dazulernen. Wir brauchen in diesem vernebelten Thema eine bessere Orientierung.
Wie viel hat Macht mit Kommunikation zu tun?
Macht ist immer ein Thema der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Sie ist der tabuisierte Teil der Sozialkompetenz. Diese hat sich seit den 1980er Jahren allerdings als Kuschelkurs etabliert. Immer geht es um Softskills, besseres Zuhören, Konsens und Kooperation. Aber natürlich gehört es auch dazu, sich durchzusetzen, zu kämpfen. Ich nenne das deshalb extra „Machtkompetenz“, da man es unter „Sozialkompetenz“ nicht vermuten würde.
Frauen wird oft eine besonders hohe Sozialkompetenz zugeschrieben. Kommunizieren sie anders als Männer?
Schon. Ich sehe da aber einen starken Unterschied zwischen den Generationen: Bei den Männern und Frauen unter 35 Jahren gibt es die Rollenunterschiede kaum noch, während die Altersgruppen darüber doch noch zum Großteil den Klischees entsprechen. Die Frauen sind hier noch stark auf Familie und Haushaltsführung sozialisiert, die Männer auf Karriere. Und sie haben einen unterschiedlichen Zugang zur Durchsetzung. Frauen kommunizieren eher auf der Beziehungsebene, agieren also mit moralischem Druck, Ersuchen oder auch Manipulation. Währenddessen setzen Männer stärker auf Verbündete, Netzwerke und Hierarchie.
Führen Frauen sanfter?
Wenn man es negativ formuliert, könnte man sagen, sie führen indirekter und intriganter. Sie kommunizieren häufiger über Emotionen. Das wird oft positiv verkauft. Ich warne allerdings davor, weil dieses Denken zugleich auch die Sackgasse ist – damit wird man nämlich zur Mutter der Abteilung. Möchte man diese Rolle überwinden, braucht es andere Machttechniken und die sind traditionell eher männlich konnotiert, was schlichtweg in der Historie begründet liegt. Frauen können sich diese aber hervorragend aneignen.
Frauen sollen sich für ihren Führungsstil also etwas von Männern abschauen?
Meine Grundbotschaft lautet: Man sollte alles, was man können will, von denjenigen lernen, die bewiesen haben, dass sie es beherrschen. Das können natürlich erfolgreiche weibliche Vorbilder sein. Aber Frauen sollten sich auch nicht scheuen, sich etwas von Männern abzugucken.
Was für Aspekte wären das?
Das kommt auf das Umfeld an, in dem Sie sich bewegen. Ich unterscheide grundsätzlich vier Schauplätze der Macht: Das politische Milieu hat ganz andere Spielregeln als die freie Wirtschaft oder Non-Profit-Organisationen und wieder andere als das Privatleben. Mein Rat ist, gut zu beobachten: Wie ist der Umgangston? Werden die „Insignien der Macht“, also Autos oder andere Statussymbole, offen oder verdeckt gespielt? Wer ist mächtig und warum? Ein Tipp besonders für Frauen: Beobachten Sie die Menschen, die Sie nicht mögen. Man beobachtet immer so gerne die, die einem gefallen, aber die handeln meistens ähnlich wie man selbst.
Ein Beispiel?
Frauen fragen sich oft: Wie schafft der Kollege es, dass ihm in der Sitzung zugehört wird, und warum gelingt mir das nicht? Spricht er vielleicht lauter und kürzer? Entschuldigt er sich nicht ständig? Begründet er nicht zuerst zehn Mal, warum er eine Idee hatte?
Heißt das, Frauen reden zu oft um den heißen Brei herum?
Sehr oft beginnen sie mit drei Erklärungen, bevor sie sagen, was eigentlich Sache ist. Ich unterscheide die Konzepte von „Ergebnis- und Beziehungssprache“. Die traditionelle Frauensprache ist die zweite: „Mir ist das und das aufgefallen, dann habe ich darüber nachgedacht, anschließend habe ich mit einem Experten gesprochen …“ Das Problem ist: Wenn es endlich um die eigentliche Idee geht, hört einem schon lange keiner mehr zu.
Aus solchen Schemata auszubrechen, fällt nicht unbedingt leicht. Müssen Frauen sich mehr anstrengen, um Karriere zu machen als ihre männlichen Mitbewerber?
Ich glaube, Frauen strengen sich oft mehr an, weil sie die falschen Dinge tun. Das Machtspiel ist relativ simpel. Etwas bissig formuliert, könnte man sagen: Die Männer haben es schließlich erfunden. Viele Frauen vermuten dahinter ein kompliziertes Konstrukt, dabei muss man sich lediglich bemerkbar machen. Frauen wollen nicht so einfach sein, deshalb strengen sie sich doppelt an. Sie machen noch eine weitere Ausbildung und hängen sich rein, während der junge Kollege leichtfüßig mit fünf Kontakten und einem abgebrochenem Studium an ihnen vorbeizieht. Dass sich Frauen mehr anstrengen müssen ist aber ein Mythos, das habe ich im Coaching oft beobachtet.
Vielleicht haben manche Frauen ja auch einfach keine Lust, sich in ein männlich dominiertes System einzufügen.
Auf viele trifft das sicher zu. Warum Sie nur wenige EU-Kommissarinnen finden und in der Wirtschaft auch nur vereinzelt Frauen in Spitzenpositionen, hat nichts damit zu tun, dass Männer das verhindern wollen. Viele Frauen sagen schlichtweg: „Das lohnt sich für mich nicht.“ Ich kenne einige Vorstandsfrauen, die wieder zurückgetreten sind, weil sie der Job nicht glücklich gemacht hat. Männer befinden sich immer noch in dem starken gesellschaftlichen Zwang, Chancen wahrnehmen zu müssen. Aber die jüngeren Männer werden ebenfalls eine größere Freiheit haben, Karriereschritte zurückzugehen.
Mit welchen Hindernissen wird eine Frau denn typischerweise konfrontiert, wenn sie nach mehr Macht strebt?
Frauen übersehen oft informelle Machtspielchen. Zum Beispiel, wenn vor einem Meeting halbaggressive Scherze hin- und herfliegen. Das sind Übungskämpfe, aus denen die Kolleginnen sich oft ausklinken. Wenn sie einbezogen werden – was eigentlich als Kompliment gemeint ist –, reagieren sie oft eingeschnappt. Frauen sollten da schlagfertiger werden und sich nicht so schnell angegriffen fühlen. In diesen Geplänkeln wird schon vieles an informellen Hierarchien abgesteckt. Drehen Sie einen sexistischen Witz lieber um und machen Sie sich nicht zum Opfer!
Oft heißt es, Frauen strebten mehr nach persönlicher Erfüllung und Sinnhaftigkeit im Job als nach Macht. Glauben Sie das auch?
Auch das ist ein Generationenthema. Für die Damen 35 Plus trifft das sicher vermehrt zu. In den Jahrgängen darunter beobachte ich auch bei den Männern, dass sie zunehmend nach Sinn, Familienorientierung und Freizeit streben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr stark karriereorientierte Frauen, die alles dafür geben, nach oben zu kommen. Hier mischen sich die Geschlechterklischees. Den Frauen über 35 fällt es oft schwerer zu akzeptieren, dass sie als Führungspersönlichkeiten nicht geliebt, sondern respektiert werden müssen und dass nicht immer ein Familienklima herrschen kann.
Apropos Familienklima: Viele mächtige Frauen geraten schnell in die Mutti-Rolle und fallen durch Fürsorglichkeit auf. Angela Merkel trägt diesen Beinamen, Christine Lagarde ist dafür bekannt, in Meetings Schokolade zu verteilen …
Das gibt es auch bei Männern, die oft als „väterlicher Patriarch“ gesehen werden. Ich würde das ignorieren. Gerade die Rolle von Frau Merkel ist ja durchaus ambivalent, auf der anderen Seite gilt sie schließlich als eiskalt. Die „Mutti“-Bezeichnung wird sie gar nicht stören. Aber andere Frauen, die sich wirklich so verhalten, sollten sich ein wenig zurücknehmen. Viele starten zum Beispiel mit selbstgebackenem Kuchen in ihren Spitzenjob. Kürzlich hatte ich eine Vorstandsfrau im Coaching, die sich rühmte, durchgesetzt zu haben, dass es in Meetings statt Brezeln nur noch Äpfel gibt. Was glauben Sie, wie sich die hauptsächlich männlichen Kollegen gefreut haben!
Wie haben Sie diese Anekdote ihr gegenüber kommentiert?
(lacht) Ich habe sie gefragt, ob sie verrückt geworden ist! Das ist genau das, was eine Mutti macht: Sie kümmert sich um die gesunde Ernährung ihrer Schar. Einer Chefin kann es aber egal sein, ob die Kollegen einen Schmerbauch bekommen oder nicht.
Um zu beschleunigen, dass mehr Frauen überhaupt in die Situation kommen, ihre Chefinnenqualitäten unter Beweis zu stellen, setzen viele ihre Hoffnungen auf die vieldiskutierte Quote …
Ich bin eine strikte Gegnerin der Frauenquote. Einerseits finde ich, dass das politisches Kleingeld ist, ein Luxusproblem. Wie viele weibliche Vorstände es gibt, ist für den Großteil der Frauen völlig irrelevant. Hinzu kommt der für mich als Coach besonders relevante wirtschaftliche Aspekt: Wenn eine Frau nicht auf jeder Ebene durch die Kraftkammer mit all ihren Unannehmlichkeiten und Intrigen gegangen ist, wird sie sich an der Spitze nicht halten. Das wäre, als würden Sie eine Slalomläuferin ohne Training die Piste hinunter schicken. Auch wenn die Ausbildung stimmt – das Wissen ist nur ein kleiner Teil. Es geht darum, die Machtspiele zu können, zu wissen, wie man sich durchsetzt. Der Anteil der Frauen nimmt zudem im mittleren Management und in den Politkadern auch ohne Quote extrem zu. Das wird oft ignoriert und nur die erste Reihe angeschaut. Dabei erreichen die gut ausgebildeten Frauen gerade jetzt das Alter und die Ebene, in der man erst einmal sein muss, um Vorstand zu werden. Daher wird es in fünf bis zehn Jahren zwangsläufig mehr Frauen ganz oben geben.
Wird sich der männlich geprägte Machtstil dann auch verändern?
Wozu sollte er sich ändern? Das System funktioniert doch. Nur weil Frauen Fußball spielen, hat sich dieser Sport doch auch nicht gewandelt. Eure Weltmeisterinnen müssen genau wie die Männer auf das Tor spielen und laufen dabei ebenfalls nicht in Stilettos. Es ist ein großer Irrtum in den Köpfen der Frauen, dass sie meinen, wenn sie aufsteigen, gibt es neue Spielregeln. Konkurrenz ist Konkurrenz – egal, welches Geschlecht man hat. Auch können Sie als Frau ein Drittel des Personals nicht „netter“ abbauen als ein Mann.
Wie gehen eigentlich Männer damit um, dass immer mehr Frauen beruflich durchstarten?
Das ist eine wichtige Frage, die in diesem Zusammenhang viel zu selten gestellt wird. Die Rollenverhältnisse in den Partnerschaften verändern sich dadurch massiv. Bisher haben sich Karrierefrauen oft einen noch erfolgreicheren Mann gesucht. Dieses Modell wird irgendwann aber statistisch nicht mehr aufgehen. Hier müssen also auch die Frauen umlernen und einen Mann akzeptieren, dem sie, was den Job betrifft, überlegen sind. Oder sie bleiben allein – es gibt ja schon jetzt viele partner- und kinderlose Frauen in Spitzenpositionen. Die Männer müssen ebenfalls umdenken. Ich kenne aus dem Coaching einige Fälle, in denen der Mann arbeitslos wurde und gerne zu Hause geblieben wäre und sich um Kinder und Haushalt gekümmert hätte, die Partnerin das aber nicht hinnehmen konnte.
Ist der Eindruck zutreffend, dass mächtige Frauen seltener mit Skandalen auffallen als Männer?
Das wird sich ändern, wenn es genügend Frauen an der Spitze gibt. Ich glaube, das ist eher ein statistisches Problem (lacht). Es werden auch unfähige und korrupte Frauen an der Macht sein – vereinzelt gibt es die ja schon. Frauen sind nicht grundsätzlich das moralischere Geschlecht.
Darin besteht aber die Sehnsucht vieler: Würden nur Frauen Entscheidungen treffen, gäbe es keine Kriege mehr …
Das ist so schrecklich und naiv! Ein solches Denken baut enorm viel Druck auf. Genau das sind die Hindernisse, die Frauenkarrieren ausbremsen: Sie sollen ganz nach oben aufsteigen, dieselben Ziele erreichen und dabei noch moralischer sein. Und weiblich. Und attraktiv. Diese Auflagen kommen allerdings interessanterweise in erster Linie von Geschlechtsgenossinnen …
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Fehler. Das Heft können Sie hier bestellen.