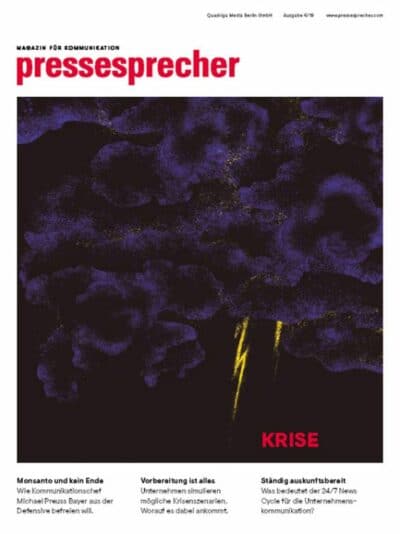Krisenkommunikation – wenn das Wort in einem Unternehmen fällt, klopfen Berater aller Art an die Tür. Ihre Empfehlungen stimmen meist – das genaue Gegenteil aber oftmals auch. Nach 40 Jahren als Wirtschaftsjournalist lautet meine These: Jeder Fall liegt anders. Lernen kann man nur aus konkreten Beispielen. Von ein paar Fällen möchte ich aus meiner Zeit als Chefredakteur des „Handelsblatt“ berichten.
Telekom: Chef außer Rand und Band
2008 erschüttert die „Telekomgate“-Affäre den Bonner Konzern. Es geht um die monatelange rechtswidrige Bespitzelung von Aufsichtsräten, Betriebsräten und Journalisten. Auch der amtierende Chef des Vorstands, René Obermann, gerät unter Druck, obwohl die ganze Aktion das Werk seines Vorgängers war.
Vorwürfe werden laut, Obermann habe sich an der versuchten Vertuschung der Affäre beteiligt. Rücktrittsforderungen stehen im Raum. Das Handelsblatt berichtet sehr kritisch über Obermann. In dieser Gemengelage bittet der Konzern im Telekom-Turm in Bonn zum Gespräch über die Vorwürfe – entsprechend der Empfehlung, die man von PR-Beratern immer wieder hört: Krisenkommunikation sei Chefsache.
Aber was ist, wenn ein Chef sich sichtlich nicht im Griff hat? Obermann gerät durch unsere Fragen so in Rage, dass wir, die beiden Handelsblatt-Redakteure, das Gefühl bekommen, gleich würde er uns an die Gurgel springen. Die emotionalen Ausbrüche des Chefs stehen dabei im größtmöglichen Kontrast zu den ruhigen Antworten des obersten Konzern-Juristen, der ebenfalls an dem Gespräch teilnimmt. Am Ende kann Obermann mithilfe seines Adlatus zwar viele Fragen durchaus einleuchtend beantworten. Sein gesamtes Auftreten aber weckt Zweifel an seiner Wahrhaftigkeit. Vielleicht ist es manchmal doch besser, wenn der Chef nicht selbst kommuniziert?
Vattenfall: Fehlende Empathie
Im Juni 2007 ziehen Rauchschwaden über das Kernkraftwerk Krümmel in der Nähe von Hamburg. In der Nachbarschaft bricht Panik aus. Der Betreiberkonzern Vattenfall wiegelt ab und setzt noch nicht einmal eine offizielle Störfallmeldung ab. Schließlich brenne nur ein Transformatorenhaus auf dem Gelände des Kernkraftwerks und nicht die gefährliche Anlage selbst.
Nach und nach dringen jedoch erschreckende Details an die Öffentlichkeit. Zeitweise können die Vattenfall-Mitarbeiter im Kernkraftwerk ihre Anlage nur noch mit Atemschutzmasken fahren. Der Spiegel spricht anschließend vom „Kommunikations-GAU“ für den Konzern. Doch als ich einige Monate später mit 200 Führungskräften des schwedischen Konzerns in Stockholm über den Vorfall diskutiere, schlägt mir geballte Ignoranz entgegen. Im Saal sitzen Ingenieure, Techniker und Betriebswirte, allesamt Anhänger der Kernkraft. Ihrer Meinung nach war die ganze Sache nur ein Sturm im Wasserglas und keine wirkliche Krise. Schließlich habe ja keine ernsthafte Gefahr für das Atomkraftwerk bestanden. Und technisch haben sie tatsächlich recht.
Über die Reaktionen der Öffentlichkeit und die Gefühle der Anwohner denken sie offenbar keine Minute nach, obwohl die Resonanz für Vattenfall verheerend ist. Zwischen den obersten Managern des Konzerns, die zu diesem Zeitpunkt ihr eigenes Verhalten bereits durchaus selbstkritisch sehen, und der Masse der Führungskräfte klafft eine tiefe Lücke. Nach innen herrscht aus falsch verstandener Loyalität in vielen Konzernen oft eine gefährliche Wagenburgmentalität, während man sich nach außen durchaus zerknirscht gibt.
BDO: Eigentor
Eine Reihe von Skandalen erschüttert in den Nullerjahren die Bankgesellschaft Berlin. Ins Schussfeuer der Öffentlichkeit geraten dabei auch die Wirtschaftsprüfer der BDO Deutsche Warentreuhand. Sie sollen über mehrere Jahre Bilanzschummeleien in der Bank gedeckt und die Warnungen eines vorliegenden Sondergutachtens missachtet haben.
Handelsblatt und ARD-Kontraste berichten groß. Die Materie ist wie immer, wenn es um Bilanzen und die Testate von Wirtschaftsprüfern geht, sehr komplex. Für die betroffene Gesellschaft steht viel auf dem Spiel. Aber eine ganze Weile herrscht Funkstille: kein Dialog, nur empörte Dementis. Schließlich schalten die Wirtschaftsprüfer einen PR-Berater ein, der das vorschlägt, was PR-Berater in einer derartigen Situation fast immer vorschlagen: ein Gespräch zwischen BDO und Chefredaktion.
Allerdings stellt man gleich eine Bedingung für ein solches Treffen: Der freie Autor der kritischen Geschichten soll auf keinen Fall an der Diskussion teilnehmen. Man will unbedingt mit der Chefredaktion allein sprechen – und sät damit bereits eine gehörige Portion Misstrauen. Das gewünschte Gespräch findet nach einigem Hin und Her zwar tatsächlich statt, endet aber im kommunikativen Nirgendwo. Der Versuch, über die Köpfe der eigentlichen Autoren hinweg mit Chefredakteuren zu verhandeln, gehört zu den dümmsten Forderungen der „Gegenseite“. Am Schluss landen alle Einwände doch wieder bei den Autoren. Chefredakteure, die etwas auf sich halten, fällen erst dann ein Urteil, wenn sie alle „Richtigstellungen“ erneut mit ihren Autoren besprechen konnten.
Thyssenkrupp: Unter Druck setzen
Drohungen als letztes Mittel der Krisenkommunikation? Das erlebt man als Chefredakteur zum Glück nur sehr selten. Ich kann mich eigentlich nur an zwei oder drei Fälle in meiner neunjährigen Amtszeit erinnern.
2009 stellt mich der damalige Kommunikationschef von Thyssenkrupp, Jürgen Claassen, bei einem Gespräch unter vier Augen vor eine erpresserische Alternative. Entweder solle ich sofort den zuständigen Reporter des Handelsblatt von der Berichterstattung über seinen Konzern abziehen oder die Zeitung werde nie wieder Interviews mit dem Vorstand oder Exklusivinformationen erhalten. Der unangenehme Austausch findet direkt nach meinem Gespräch mit dem damaligen Konzernchef Ekkehard Schulz statt, der mir gerade ein Interview zugesagt hat.
Die kritischen Berichte des Handelsblatt-Kollegen gelten mittlerweile als so gefährlich, dass man offenbar alles auf eine Karte setzt. Was macht ein Chefredakteur in einer solchen Situation? Er informiert sofort den betroffenen Redakteur und alle zuständigen Kollegen.
Drei Jahre später holte die Welt den ganzen Vorgang ans Tageslicht, als es um weitere Verfehlungen des Kommunikationschefs ging – unter anderem den Versuch der Bestechung von Journalisten durch „Lustreisen“ in ferne Gefilde. Ein Ausnahmefall? In dieser krassen Art und Weise sicherlich. Aber in abgemilderter Form spielen Pressechefs leider das gleiche Spiel in der Krise ihres Konzerns immer wieder: Interviews und Informationen nur für die „braven“ Medien, Informationsentzug für die „zu kritischen“. Das Gegeneinander-Ausspielen von Medien gilt mancherorts sogar als Königsdisziplin der Krisen-PR. In Wahrheit kommt das Gegenteil dabei heraus, was die Kommunikatoren erreichen wollen: Die Kette der negativen Berichte reißt nicht ab.
Kann man allgemeine Lehren aus den vier Fällen ziehen? Vielleicht: Nur die Konzerne, die sich schon in normalen Zeiten ethisch einwandfrei verhalten und offen kommunizieren, werden auch in schwierigen Situationen ihre Sicht der Dinge an den Mann bringen. Man nennt es Vertrauenskapital. Wenige Unternehmen sammeln es systematisch an.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KRISE. Das Heft können Sie hier bestellen.