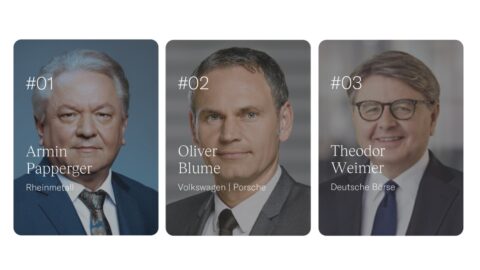Herr Buschardt, was ist für Sie gute Krisenkommunikation?
Tom Buschardt: Gute Krisenkommunikation informiert wahrheitsgemäß, beschönigt nicht und hat so die Chance, einen Imageschaden von einem Unternehmen abzuwenden. Schlechte Krisenkommunikation hingegen verbrennt Ressourcen und kostet das Unternehmen unter Umständen viel Geld. Es heißt oft, Aufgabe eines Pressesprechers sei es, aus üblem Mist leckere Minze zu machen. Unsinn! Dem Geschmack lassen sich höchstens Aromen zufügen. Mist bleibt immer Mist.
Inwieweit unterscheidet sich die Kommunikation in Krisen und in Schönwetterzeiten?
In Krisen sind Unternehmen stärker mit negativen Emotionen konfrontiert. Extern wie intern. Die Medien sind in der Regel auf der Seite des vermeintlich Schwächeren. Die Vergangenheit hat ja auch leider immer wieder gezeigt, dass Unternehmen dazu neigen, Unliebsames unter den Teppich zu kehren. Dass Medien nachhaken, ist deshalb nicht verwunderlich. Es ist ihre Aufgabe.
Bitte ein Beispiel: Wer hat zuletzt erfolgreich in einer Krise kommuniziert?
Besonders gelungen war die Kommunikationsstrategie der Münchner Polizei nach dem Amoklauf im Juli vergangenen Jahres. Ihr Pressesprecher Marcus da Gloria Martins hat ehrlich, ruhig und sachlich informiert, gleichzeitig aber auch Grenzen gesetzt und Journalisten auf Abstand gehalten. Auf die Frage, was die Polizei jetzt tun werde, antwortete er ganz einfach: „Wir machen jetzt unsere Arbeit.“ Das war nicht das, was der Journalist hören wollte, aber genau das, was angemessen war. Damit hat der Pressesprecher deutlich gemacht: Bis hierhin kommunizieren wir und weiter nicht.
Und wer hat keine gute Figur abgegeben?
Katastrophal war aus meiner Sicht die Kommunikation von Vattenfall 2007, nachdem ein Transformator auf dem Gelände des inzwischen stillgelegten Atomkraftwerks Krümmel Feuer gefangen hatte. Der Brand war nur eine von mehreren Pannen in den zwei von Vattenfall betriebenen schleswig-holsteinischen Meilern Krümmel und Brunsbüttel, über die das Unternehmen die Öffentlichkeit nur bruchstückhaft und teilweise sogar falsch informiert hat. Ein fataler Fehler. Vattenfall musste anschließend einen Millionenbetrag für eine Imagekampagne ausgeben, um den entstandenen Schaden zu beheben.
Woran liegt es, dass Unternehmen oft mangelhaft kommunizieren?
Viele Unternehmen bereiten sich nicht ausreichend für den Fall einer Krise vor. Sie haben nicht systematisch die Themen im Blick, die ihnen gefährlich werden können. Diese Bequemlichkeit rächt sich: Wenn die Krise ausbricht, trifft sie das Unternehmen wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Ehrlichkeit gilt als Schlüssel, um eine Krise erfolgreich zu bewältigen. Warum ist es so wichtig, ehrlich und offen zu kommunizieren?
Es gibt ein Sprichwort, das den meisten von uns in der Kindheit eingeschärft wurde und das es auf den Punkt bringt: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.“ In der Krise ist es besonders wichtig, mit Ehrlichkeit wieder Vertrauen zu schaffen. Menschen sind in der Regel bereit, Fehler zu verzeihen. Das gilt aber nicht, wenn Unternehmen nicht bereit sind, aus ihnen zu lernen, und sie als Banalität abtun. So ein Verhalten ist meist ein viel größeres Problem als der eigentliche Auslöser der Krise.
Überwiegt denn nicht eher in der PR-Arbeit das Beschönigen gegenüber dem ehrlichen Informieren?
Die Arbeit eines Pressesprechers ist ein ständiger Spagat. Er steht als Vermittler zwischen dem Management, das sich um das Ansehen des Unternehmens sorgt, und den Medien, die ein berechtigtes Informationsbedürfnis haben.
Wie ehrlich muss ein Unternehmen gerade in der Krise sein?
In der VW-Dieselaffäre wäre schonungslose Offenheit von Anfang an geboten gewesen. Die Videobotschaft, mit der der damalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn erstmalig zu den Vorwürfen Stellung nahm, war in dieser Hinsicht eine Katastrophe. Seine Aussagen blieben vage. Er las vom Teleprompter ab und wirkte wie in Schockstarre. Auf diese Weise konnte Winterkorn kein Vertrauen zurückgewinnen. Die Unternehmensführung hätte zu dem Zeitpunkt noch eine Chance gehabt, sich an die Spitze der Aufklärung zu stellen, doch die hat sie vertan. Winterkorn hatte bereits bei früheren Auftritten Schwächen am Teleprompter gezeigt. Das lag also nicht an der Krise allein.
Wie weiß ein Sprecher, wann absolute Offenheit gefragt ist?
Das ist Definitionssache. Unternehmen müssen keine schützenswerten Produktionsabläufe offenlegen. Entscheidend ist, wie die Öffentlichkeit die Krise wahrnimmt.
Gibt es Abstufungen der Offenheit?
Ja, es ist durchaus üblich, dass Sprecher mit Journalisten darüber verhandeln, geplante Berichte für einen oder zwei Tage zurückzuhalten, weil man beispielsweise Zeit benötigt, um einen Missstand zu beheben, der sich durch eine vorschnelle Veröffentlichung noch verschlimmern würde – wie das Schließen einer Sicherheitslücke in der EDV, die sonst noch von außen angreifbar wäre. Dafür muss man Journalisten aber natürlich auch etwas anbieten, etwa exklusive Informationen, damit das Geschäft auf Gegenseitigkeit beruht.
Gibt es Grenzen der Offenheit? Ist auch mal Flunkern erlaubt?
Flunkern? Auf gar keinen Fall! Allerdings gibt es Situationen, in denen man zum Schutz des Unternehmens Informationen nicht an die große Glocke hängt oder vorerst zurückhält. Pressesprecher unterliegen auch Sachzwängen. Nicht selten müssen erst rechtliche Fragen geklärt werden, bevor sie die Freigabe erhalten, über bestimmte Details zu sprechen.
Daniel Abbou war einmal Sprecher des Flughafens Berlin-Brandenburg – dann gab er ein sehr offenes Interview und wurde entlassen. Was ist schiefgelaufen? Hat er nicht eigentlich alles richtig gemacht?
Abbou hat einiges richtig gemacht, aber nicht alles. Er hat in dem Interview offen Kritik an seinem Chef geübt – und das geht gar nicht.
Trotzdem haben Sie ihn in einem Kommentar als Vorbild für die PR-Branche bezeichnet. Hat Abbou mit seiner Ehrlichkeit nicht dem Unternehmen geschadet?
Nein, das sehe ich anders. Abbou hat sicherlich etwas barock formuliert. Aber mal ehrlich: Die ganze Welt lacht über die Pannen am BER. Abbou hat letztlich nur gesagt, was alle wissen. Dass er so unverblümt die Wahrheit ausspricht, empfinde ich als positiv. Endlich kommt mal jemand, der Klartext spricht und dem man Vertrauen schenken kann.
Waren seine Aussagen nicht zumindest ungeschickt?
Hier muss man unterscheiden: Abbous Ehrlichkeit bezüglich der Probleme des BER war richtig, die offene Kritik an seinem Vorgesetzten nicht. Die war tatsächlich ungeschickt. Solche Kritik gehört in ein Vier-Augen-Gespräch, nicht in die Öffentlichkeit. Ein Stück weit jedoch ist Abbou auch Opfer der Medien geworden, die immer die gleichen aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate voneinander abgeschrieben haben. Kaum ein Journalist schien das komplette Interview gelesen zu haben, denn es lag hinter einer Bezahlschranke von zwölf Euro. Ein Versäumnis, denn im Kontext wirken Abbous Aussagen weit weniger drastisch als isoliert.
Ist die Kündigung, wie im Fall von Abbou, das typische Schicksal eines zu ehrlichen Sprechers?
Es kommt vor, dass Sprecher illoyal sind und der Presse etwas durchstechen, weil sie sich über Vorgesetzte geärgert haben. Sie spielen in solchen Fällen mit ihrem Job. Denn wenn Medien dies aufgreifen, haben sie verloren. Dann endet es so wie im Fall Abbou – zu Recht. Die Loyalität eines Sprechers gehört seinem Arbeitgeber. Das heißt aber keinesfalls, dass er offensichtliche Fehler und Versäumnisse im Unternehmen nicht öffentlich benennen sollte.