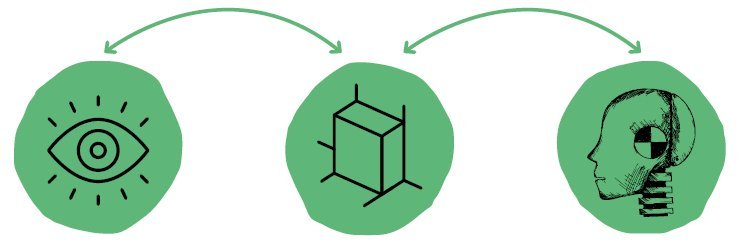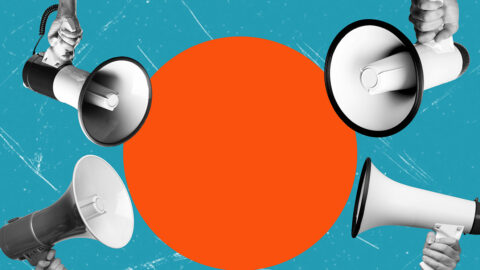Vor einem Jahr ließ Bernd Engelien eine Wand in seiner Abteilung einreißen. Er wollte Freiraum schaffen für seine acht Mitarbeiter. Raum für Austausch und Ideen. Der 47-Jährige ist Leiter Unternehmenskommunikation der Zurich Gruppe Deutschland, eines Versicherungsunternehmens mit 5.200 Mitarbeitern, das zur international tätigen Schweizer Zurich Insurance Group gehört.
Vergangenes Jahr stand der Versicherer wegen Sparmaßnahmen, Stellenabbau und Konzernumbau in den Schlagzeilen. Der neue Vorstandsvorsitzende Marcus Nagel hatte ihm ein Effizienz- und Investitionsprogramm verordnet: Produkte und Services sollen schneller und kundenorientierter entwickelt werden. Er entschied sich, diese Strategie unter anderem mit Design Thinking umzusetzen. Bereits 2015 hatte er, damals noch Vorstand des Lebensversicherungsgeschäfts, die Idee für die Innovationsmethode beim Versicherer als Pilotprojekt initiiert. Es wurden sogenannte Champion Teams gebildet, die für unterschiedliche Zielgruppen im Design-Thinking-Prozess Versicherungslösungen produzieren sollen.
Unschlüssige Herkunft
Was bedeutet „Design Thinking“ eigentlich genau? Der Überlieferung nach fiel der Begriff 1991 auf einem Symposium, an dem auch die Gründer der Innovationsberatung Ideo saßen. Übersetzt heißt er erfinderisches Denken. Ideo entwickelte daraus eine Methode für wirtschaftliche Innovationen: den heute vielzitierten iterativen Design-Thinking-Prozess. Er basiert auf sechs Phasen: Verstehen (Empathize), Beobachten, Definieren der Sichtweise (Define), Finden von Ideen (Ideate), Herstellung eines Prototyps (Prototype) und das Testen (Test). Der Prozess wird von interdisziplinären Teams bis zur verwendbaren Lösung wiederholt, mit dem Ziel, sich vom Dogma des Experten- und Einzelkämpfertums fortzubewegen. Fehler sind erwünscht, um schnell aus ihnen zu lernen. Ideen werden greifbar gemacht, das Denken geschieht vorurteilsfrei. Dieser Dynamik wird auch real Platz geschenkt: Stehtische, verschiebbare Möbel, Musik, Knete, Lego – die Räume, in denen Produkte und Prozesse innoviert werden, sind frei von Sitzordnung und Powerpoint-Präsentationen. Je nach Nutzer variieren Anzahl und Benennung der Phasen ebenso wie die Anwendung. Die Methode hat keine wissenschaftliche Historie, sie entstand aus der Praxis und ähnelt einer Ideologie.
Was ist Design Thinking?
Design Thinking ist ursprünglich eine Kreativmethode, um komplexe Probleme zu lösen. Sie ist der nutzerorientierten Denkweise von Designern entlehnt
und basiert auf der Annahme, dass Ideen erfolgreich sind, die interdisziplinär, experimentell und konsequent nutzerorientiert entstehen.
Mittlerweile wird Design Thinking nicht nur für Produktinnovationen genutzt, sondern auch für bessere Services, Prozesse, Strukturen und Businessmodelle.
Durch das vernetzte Denken kann eine neue Arbeitskultur in Unternehmen entstehen, die die Anpassungsfähigkeit an eine sich verändernde Umwelt erleichtert.
„Design Thinking“ gleiche einem Passepartout-Begriff, schreibt die Designwissenschaftlerin Claudia Mareis in „Design als Wissenskultur“. Er oszilliere demzufolge in seiner Anwendung zwischen einem allgemeinen Erfindergeist und den spezifischen Fertigkeiten von Designern. Gemeinsamer Nenner dieser beiden Lesarten sei, dass Design durch Design Thinking als Denkweise idealisiert werde. Denn der Design-Thinking-Prozess ähnelt der intuitiven Arbeitsweise von Designern. Sie arbeiten nutzerorientiert, visualisieren, was sie denken, stellen Fragen, lösen Vorhandenes auf und setzen es neu zusammen; sie probieren aus. Eigentlich müsse es Design Doing heißen, schreiben daher die Autoren in der Journalistenwerkstatt-Ausgabe zum Thema „Design Thinking“.
Design Thinking in Deutschland
Michael Schwertel wollte wissen, wie Design Thinking Unternehmen erfolgreich macht, und flog vergangenes Jahr ins Silicon Valley. Er schult Kommunikatoren in der Innovationsmethode und ist Professor für Medienmanagement an der Cologne Business School sowie Geschäftsführer einer Animationsfirma. Drei Firmen besuchte er täglich auf seiner Reise; keine einzige sagte ihm ab, alle zeigten ihm, wie sie arbeiteten – und er sah: Im Herzen jedes Unternehmens, ob Pixar, Tesla, Google oder Facebook, wird Design Thinking angewandt.
Er hätte sich auch gern mit einem deutschen Buchautor darüber ausgetauscht, fragte ihn vor der Reise an. Zwei Monate nachdem er wieder in Deutschland war, bekam er einen Termin. „Deutschland ist hermetisch verriegelt, man spricht hier einfach nicht miteinander“, lautet Schwertels Bilanz. Das Absurde: Die Deutschen hätten das Potenzial, innovativ zu sein. Das Silicon Valley sei voll von ihnen.
Hierzulande wird der Innovationsprozess seit 2012 zunehmend populärer; Unternehmen fragen sich: Wie schaffen wir es, über Abteilungen, Länder und Kontinente hinweg zusammenzuarbeiten? Wie können wir Prozesse beschleunigen, Produkte schneller entwickeln? Wie kann Identifikation zwischen Mitarbeitern und der Unternehmensstrategie geschaffen werden? Ulrich Weinberg rief 2015 durch eine Publikation zum Network Thinking auf. Die vernetzte Denk- und Arbeitswelt zwingt uns laut dem Gründer des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI), analoges Silo-Denken aufzugeben. Design Thinking biete die notwendigen Kräfte für diesen Kulturwandel.
Der Design-Thinking-Prozess
1. Verstehen: Das Problem umreißen <–> 2. Beobachten: Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers erforschen <–> 3. Sichtweise definieren: Ergebnisse auf eine Sichtweise fokussieren
4. Ideenfindung: Möglichst viele, auch abseitige Lösungsvorschläge finden <–> 5. Prototyping: Ideen in ersten Prototypen erlebbar machen <–> 6. Testen des Prototyps
Illustrationen: www.thinkstock.com
Laut HPI Study Report „Parts without a Whole?“ (2015) ist bei rund einem Drittel der befragten Unternehmen, die Design Thinking nutzen, die Denkweise auch in die Kultur übergegangen. 71 Prozent von ihnen nahmen positive Auswirkungen auf die Arbeitskultur wahr, speziell in Teams. Die Methode wächst demnach langsam über die Ideenentwicklung hinaus und optimiert Innovationsprozesse und damit auch Unternehmenskulturen. Dieser Eindruck basiert auf den Antworten von rund 235 Anwendern, darunter hauptsächlich ICT-Unternehmen, Universitäten, Chemie- und Pharmaunternehmen, Autohersteller und Banken.
Der Gründer des Company Builders Partake, Jürgen Erbeldinger, und Wirtschaftsjournalist Thomas Ramge schreiben hingegen in „Design Thinking in der Praxis“, die langsame europäische Design-Thinking-Szene betreibe die Methode häufig im Konjunktiv. Innovative Ideen würden in den Organisationen zerrieben, sie blieben Lippenbekenntnisse. Was sich die meisten Unternehmen wünschen, so sind sich die Autoren sicher, sei Zuverlässigkeit. Obwohl der Innovationsdruck stetig wachse, bedienten sie sich jedoch weiterhin veralteter Managementmethoden: Es werden Ressourcen verteilt, Budgets festgelegt, es wird Macht verliehen, belohnt und entschieden. Das Management selbst samt seinen verstaubten Glaubenssätzen müsse also innoviert werden.
Kein Wunder, dass die PR-Branche erst langsam mit der Methode in Berührung kommt. Vor allem Agenturen öffnen sich zunehmend für die neue Arbeitsweise, eine wachsende Anzahl an Design Thinkern, abseits des HP-Instituts, offerieren ihr Wissen. Doch in der Abteilung Unternehmenskommunikation weht noch kaum frischer Design-Thinking-Wind.
Produktzyklen verkürzen
Der Züricher Versicherer hat den Kreativprozess auch erst einmal zur Produktinnovation ins Unternehmen geholt. Mit ersten Erfolgen. Das Champion Team Generation Y hat einen digital verfügbaren Reiseversicherungsschutz in zwei Monaten umgesetzt. Ungewöhnlich für Produktzyklen, die sonst ein bis zwei Jahre dauern. „Es ist erst einmal ungewohnt, in dieser Geschwindigkeit Entscheidungen zu treffen, und es läuft natürlich nicht sofort reibungslos, weil man bekannte Freigabeprozesse abkürzt“, sagt Bernd Engelien. „Aber man merkt bereits jetzt, dass die Methode Motivation erzeugt.“ Wichtig war, dass die interdisziplinären Teams frühzeitig und eng mit den Fachbereichen zusammenarbeiten, sodass die agile Arbeitsweise auch auf sie übergeht. Irgendwann. „Wir müssen sensibel sein und dürfen den Fachbereichen nicht suggerieren, dass sie in der Vergangenheit schlecht gearbeitet haben. Es geht vielmehr darum, zu zeigen, was wir tun müssen, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind“, sagt Engelien. „Es gibt natürlich auch Standards, die einen stabilen Prozess brauchen, aber dort, wo der Kunde Maßstab ist, müssen wir reagieren.“ In den mittlerweile sechs etablierten Champion Teams sitzen zehn bis 15 Mitarbeiter, alle sind professionell geschult worden. Für die Arbeit der Teams wurden Kaffeezonen mit Sitzsäcken und eine spezielle Design-Thinking-Umgebung geschaffen. „Das allein hilft natürlich nicht. Aber es gibt dem Prozess ein Gesicht, und schon interessieren sich die anderen dafür, verlieren ihre Skepsis.“
Design Thinking in der Kommunikation
Diese Art zu arbeiten wünschte sich Bernd Engelien auch für die Unternehmenskommunikation und schaffte die Trennung von interner und externer Kommunikation ab. „Kommunikatoren müssen in Zeiten des Smartphones deutlich stärker eine 360-Grad-Perspektive einnehmen“, sagt er. Fortan wird ein Thema individuell für die verschiedenen Empfängerbedürfnisse der Kanäle aufbereitet. Den einen klassischen Intranet-Verantwortlichen gibt es nicht mehr.
Im ehemals verwaisten Flügel der damaligen Vorstandssekretariate entdeckte der Kommunikator außerdem eine jagdgrüne Fünfzigerjahre-Plüschgarnitur, ideal für PR-Kreativmeetings. Die obligatorische Kaffeemaschine hat der Vorstand spendiert. „Diese bequeme Sitzecke ist der Kontrapunkt zu unserem Newsroom-Bereich, in dem für den schnellen Austausch nur Hocker stehen“, sagt Engelien. Er hat sich Design Thinking auf eigene Faust angeeignet und nutzt einzelne Aspekte der Innovationsmethode für seinen PR-Alltag: „Ich habe mir Wissen aus dem Unternehmen geholt, ‚Management Y‘ gelesen und viel recherchiert. Es ging dann für mich darum, zu überlegen, wie wir Geschichten besser entwickeln zu dem Zeitpunkt, an dem die Produkte und Strategien entstehen.“
Die Unternehmenskommunikation sollte mit am Tisch sitzen, wenn die Champion Teams oder andere Fachbereiche an Produkten feilen – und gegebenenfalls intervenieren. „Es kommt schon vor, dass wir zu Produktideen sagen: Das lässt sich so nicht kommunizieren. Markt und Medien interessieren sich für etwas anderes.“ Oder das Thema ist noch nicht verständlich genug. Ein Beispiel ist eine Studie zum Thema Langlebigkeit. Nach der ersten Auswertung merkte das PR-Team, dass sich aus den erhobenen Daten keine Story generieren lassen wird, die Daten waren zu erklärungsbedürftig. Engelien versammelte Experten aus Lebens-, Renten- und Sachversicherung sowie Fachfremde; sie formulierten die Fragen neu, drehten den Ansatz. „Armut kostet den Menschen elf Jahre Lebenszeit“, titelte dann im Dezember Die Welt und nahm die Studie auf. Ein Erfolg. Engelien und sein Team lernten daraus, dass sie das nächste Mal bereits bei der Entwicklung der Fragen dabei sein sollten.
Prototypen zur Verfügung stellen
Kommunikation wurde so Bestandteil des Produkts. In vielen Unternehmen sind Innovations-, Produktions- und Kommunikationsprozesse jedoch noch nicht auf diese Weise miteinander verbunden. Der größte Trugschluss hierzulande sei, dass ein gutes Produkt sich auch automatisch gut verkaufe, sagt Professor Michael Schwertel. Doch Qualität allein reiche nicht aus. „Man sollte schon zu Beginn des Produktionsprozesses die Aussage eines Produkts identifizieren und kommunizieren.“
Eine Trendstudie zur Innovationskommunikation von Professor Ansgar Zerfaß und der Agentur Fink & Fuchs ergab: Nur jedes zehnte Unternehmen bindet die PR frühzeitig in die Produktentwicklung mit ein. Für die nicht repräsentative Studie wurden 40 Kommunikatoren und 30 Innovationsmanager befragt. Das war 2008. Fink & Fuchs hat keine Neuauflage dieser Studie geplant. Vorstandsmitglied Alexandra Groß sagt dazu: „Ich würde mal die nicht belegbare These wagen, dass sich dieser Zustand nicht sprunghaft verändert hätte. Es sind immer noch nur vereinzelte Unternehmen, bei denen die PR bei Entwicklungsprozessen mit am Tisch sitzt.“ Die meisten Unternehmen trauten sich erst an die Kommunikation, wenn das Produkt bereits Marktreife erlangt habe. „Design Thinking arbeitet ganz anders: Man geht mit einer Beta-Version an den Markt, denn nur so bekomme ich das Feedback von den Kunden, und das Produkt wird so, wie sie es auch haben wollen.“ Groß plädiert dafür, die Öffentlichkeit bereits neugierig auf ein neues Produkt zu machen, wenn es noch nicht fertig ist. „Hierzulande sind die Produktentwickler sehr vorsichtig, haben einen 150-Prozent-Anspruch, wollen überprüf- und belastbar sein. Das ist das Gegenteil von Design Thinking.“ Professor Schwertel rät, sich an Tesla zu orientieren: Erst einmal durch Rapid Prototyping 80 Prozent geben und das Produkt dann durch Updates verbessern. Autos von Tesla erhielten beispielsweise im Nachgang ein Batterie-Update. Elon Musk, Vorstandsvorsitzender des amerikanischen Elektroauto-Herstellers, twitterte das selbst, und die Fahrer konnten die Batterien umgehend austauschen.
Wer ist mein Kunde?
Die Agentur Fink & Fuchs arbeitet seit zwei Jahren mit der Innovationsmethode: Teams wurden durch Coaches geschult, jeder neue Mitarbeiter geht durch eine zweitägige Schulung. Der Prozess wurde außerdem permanent in die Konzeptionsmethodik aufgenommen. „Bevor wir eine Situationsanalyse für ein PR-Konzept erstellen, schauen wir uns die Zielgruppe des Kunden an. Dies steht ganz am Anfang“, sagt Groß. „Statt zu fragen: Was kann mein Produkt, was kann mein Unternehmen? Und daraus zu schlussfolgern und Maßnahmen zu entwickeln, reden wir mit dem potenziellen Kunden, der das Produkt am Ende kaufen soll.“ Das tut man im Design-Thinking-Prozess mit sogenannten Empathy Interviews. Empathie – etymologisch betrachtet, die Leidenschaft (empátheia), auch Seelenbewegung (pathos) – ist eines der Schlüsselwörter der Digitalisierung. Der Kommunikator als Berater im Unternehmen und Vermittler zwischen interner und externer Kommunikation braucht besonders viel davon.
Wer ist mein Kunde? Was sind seine Bedürfnisse? Design Thinking ist kein Allheilmittel, das diese zentralen Fragen erschöpfend erklärt. Aber die Methode ist ein Weg, mehr Nutzerfokus in den Köpfen der Mitarbeiter zu schaffen. Sie zwingt dazu, Zeit mit dem Kunden zu verbringen, anstatt über ihn nachzudenken. Sind meine Zielgruppe Autoliebhaber, gehe ich ins Autohaus und führe dort Empathy Interviews. Sind es Techies, gehe ich zu einem Hackathon. Sind es Absolventen, führt mein Weg in die Universität, in die Mensa. Innovationen entstehen dadurch nicht mehr rein aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen, sondern werden aus dem Kundenbedürfnis heraus entwickelt. „Wider Erwarten finden es die meisten Kunden schön, endlich gefragt zu werden. Dieser Dialog ist für beide Seiten spannend“, sagt Katharina Böhnke. Die Design-Thinkerin ist Mitgründerin des Berliner Ideenlabors. Wie viele Nutzer man befragt, sei dabei ein skalierbare Größe.
Content Marketing
Design Thinking biete sich vor allem im Content Marketing an, da die Methode helfen kann, wenn das Ziel unscharf ist, es sich um versteckten, gar künftigen Bedarf handele, schreibt Content-Marketing-Beraterin Tanja Josche im Blog Lean Content Marketing. Die Themenplanung für die unterschiedlichen Kanäle ist so eine adaptive Aufgabe, das Gegenteil von technischen Aufgaben. Letztere, so unterscheiden es die Autoren der Journalistenwerkstatt, bergen häufig ein klar umrissenes Problem, das mit Analyse und Sachkenntnis gelöst werden kann. Adaptive Aufgaben hingegen sind chaotisch, unscharf – Frage und Antwort nicht eindeutig. Hier ist der Nutzer gefragt, Design Thinking kommt ins Spiel.
Zuletzt wollte ein Kunde von Katharina Böhnke im Rahmen einer neuen Kommunikationsstrategie den Newsletter relaunchen. Gemeinsam mit dem Kunden führte das Ideenlabor Interviews mit einem Dutzend Leser, und heraus kam: Die Nutzer lesen die Inhalte vor allem unterwegs. Sie brauchen also einen mobil optimierten Newsletter mit kurzen Schlagzeilen und wünschten sich Inhalte, die sie in ihrem Alltag sofort umsetzen konnten. Internes aus dem Unternehmen interessierte sie kaum. Außerdem wurde klar, dass der Verteiler des Newsletters gruppiert werden muss, sodass verschiedene Zielgruppen individuellen Inhalt bekommen. Das klingt einleuchtend, banal – aber dennoch folgen die meisten Newsletter dieser Logik nicht. Mit den Erkenntnissen wurde ein erster Prototyp, ein Mockup, gebaut, der im nächsten Schritt iterativ auf Basis der Nutzerbedürfnisse getestet worden ist. Die Daten seien alle bereits im Unternehmen gewesen, sagt Katharina Böhnke. Sie mussten nur neu aufbereitet werden.
Kein Aktionismus
Also alles Bisherige über den Haufen werfen? Keineswegs. Es gehe nicht darum, sich durch die neuen Erkenntnisse einen riesigen Aufgabenberg aufzuhalsen, sagt Katharina Böhnke. Man solle daraus eine zentrale Erkenntnis ziehen und diese mit dem kleinstmöglichen Aufwand iterativ umsetzen, auf Basis des Bestehenden. Die persönliche Essenz, die der Agenturvorstand Alexandra Groß für sich aus der neuen Arbeitsweise gezogen hat: Man müsse das Problem in einem Satz auf den Punkt bringen können. „Man erwartet das nicht, aber wir verbringen in unseren Kreativmeetings oft eine Stunde mit der Formulierung der eigentlichen Problemstellung“, sagt sie und lacht. Eine halbe Stunde dann mit den Kreativitätstechniken. Bernd Engelien beobachtet, dass die Kommunikationsabteilung noch umfassender als strategischer Berater wahrgenommen wird, seitdem sie im Design-Thinking-Prozess auch an Produktentwicklungen beteiligt ist.
Spannend wird die Methode auch für noch unerschlossene Gefilde, wie Virtual Reality und PR. 2017 wird das Jahr für Virtual Reality, prognostiziert Professor Michael Schwertel. „Facebook hat nicht umsonst 2014 den Virtual-Reality-Brillen-Hersteller Oculus VR gekauft.“ Virtuelle Realitäten sind vom Computer berechnete Welten. In ihnen könnten Kunden beispielsweise Probefahrten oder virtuelle Besichtigungen noch nicht gebauter Objekte erleben.
Man könne ja erst einmal klein anfangen und eine Pressekonferenz als 360-Grad-Video streamen, sagt Schwertel. „Die Technologie ist noch so neu, dass niemand so richtig weiß, wie man sie am besten einsetzt.“ Die Kameras jedenfalls seien erschwinglich. Jetzt könnte man ein interdisziplinäres Team zusammenrufen und ein paar Empathy Interviews führen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KREATIVITÄT. Das Heft können Sie hier bestellen.