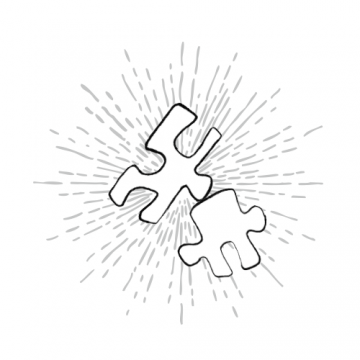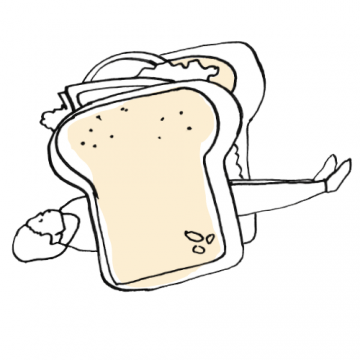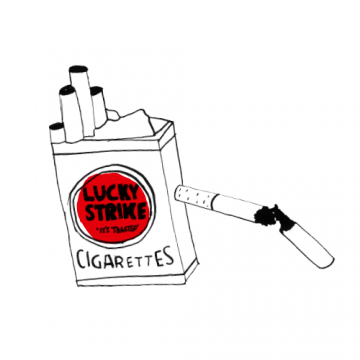Die selbstbewusste amerikanische Frau trug im Jahr 1929 die Farbe Grün. Grund dafür war, glaubt man der Anekdote, eine ausgefeilte PR-Kampagne von Edward Louis Bernays. Der Neffe Sigmund Freuds, der als einer der Gründerväter der Public Relations gilt, war davon überzeugt, ein erfolgreicher Kommunikator müsse immer auch ein beflissener Sozialwissenschaftler sein. Als die American Tobacco Company ihn also in besagtem Jahr rekrutierte, um auch Frauen zur Zielgruppe ihrer Marke Lucky Strike hinzuzugewinnen, konsultierte Bernays zunächst einen Psychoanalytiker. Dieser verwies auf den phallischen Symbolcharakter der Glimmstengel und gab zu bedenken, sie weckten bei Damen den berüchtigten freudschen Penisneid. Was war also zu tun, um jene dennoch vom Genuss der Zigarette zu überzeugen? Bernays holte die „richtigen“ Menschen auf seine Seite: Vertreter der Modeindustrie entwarfen Kleider im Grünton der Lucky-Strike-Packung, Ärzte bescheinigten die vermeintliche Harmlosigkeit des Tabakkonsums und eine Gruppe Frauen zündete sich im Auftrag des PR-Manns mitten in New York voller Pathos Zigaretten als „Fackeln der Freiheit“ an. Bernays Ziel: Die Marke sollte sich in den Köpfen der Bürgerinnen als Symbol der Emanzipation etablieren.
Illustration: Mona Karimi
Der Sprecher als Sozialtechniker
Nun sind sowohl Freuds Psychoanalyse als auch Bernays propagandistische Auslegung von PR heute kaum noch die professionellen Mittel der Wahl. Und doch demonstriert dieses Beispiel, den – viel zu oft vernachlässigten – gegenseitigen Einfluss von PR und Psychologie.
„Praktisch gesehen sind Kommunikatoren Sozialtechniker“, sagt Susanne Femers. Die Diplompsychologin ist Professorin für Wirtschaftskommunikation an der HTW Berlin. Nach ihrem Studium wandte sie sich der PR zu, war acht Jahre lang in der Kommunikation tätig. Femers empfand es zu dieser Zeit als unbefriedigend, dass viele Fragen offen blieben: Warum funktioniert eine Kampagne? Wie lassen sich Misserfolge dem Kunden erklären? Sie kehrte in die Wissenschaft zurück, um ihre Eindrücke aus der Kommunikationspraxis zu sortieren und wissenschaftlich aufzubereiten. Ihre Ergebnisse fasste sie im Beitrag „Public Relations aus sozialpsychologischer Sicht“ für das Handbuch der PR zusammen. „Als Praktiker versprechen wir oft viel mehr, als wir halten können“, lautet ihr zunächst ernüchterndes Resümee. „Viele PRler überschätzen die Rolle der Kommunikation“, glaubt Femers. Es reiche nun einmal nicht, alle wichtigen Sachargumente auszubreiten und sich darauf zu verlassen, dass die Menschen diesen folgen werden. Auch wenn man für ein Produkt oder Unternehmen kommuniziere, von dem man selbst absolut überzeugt ist. „Mein Produkt ist gut. Ich muss das nur richtig erklären, dann werden die Menschen es schon verstehen und annehmen“, glauben viele Kommunikatoren. Und tappen in die Falle ihrer eigenen Unwissenheit.
Sozialpsychologische Theorien können helfen, die soziale Wirklichkeit von Kommunikation zu ordnen. Zudem erlauben Sie Prognosen, erklären die Welt der Kommunikation und können darüber hinaus neue Zusammenhänge offenlegen. Für den Anfang kann es oft schon reichen, sich als PRler bewusst zu machen, was in der Kommunikation trotz aller Mühen nicht funktioniert. Zum Beispiel, wie schwer es ist, die Einstellungen und Werte von Menschen zu verändern. Schließlich hat das alte Modell eines manipulativen Senders und passiven Empfängers längst ausgedient.
Illustration: Mona Karimi
Das kleine Einmaleins der Sozialpsychologie
„Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie“, so ein vielzitierter Satz des Sozialpsychologen Kurt Lewin. Das gilt gewiss auch für die PR. Besonders das Elaboration Likelihood-Modell der Psychologen Richard E. Petty und John T. Cacioppo ist jedem Kommunikator ans Herz zu legen. Den Psychologen zufolge gibt es zwei Wege, um andere zu überzeugen: den zentralen und den peripheren. Verfüge ich über Informationen, die als solche schon starke Überzeugungskraft haben, und ein Publikum, das interessiert ist und bereits ein Vorwissen zu dem Thema hat, kann ich den zentralen Weg wählen und mit Sachargumenten überzeugen.
Der zweite, indirekte Weg erfordert hingegen deutlich weniger Nachdenken bei meinem Gegenüber, da er mit Assoziationen arbeitet. Wirbt der Mann mit dem gestählten Körper für ein Fitnessstudio, ist die Botschaft implizit. Auf solche Reize reagieren wir automatisiert statt, wie im Fall der Sachüberzeugung, reflektiert.
Galt die periphere Route früher als klar werbliche Methode des Überzeugens, ist sie laut Susanne Femers heute auch für die PR relevant. „Viele Kampagnen in der PR bedienen sich inzwischen auch werblicher Mittel, wählen beide Informationswege. Die Hoffnung ist, dass die weniger Interessierten über den oberflächlichen Weg der Assoziation einsteigen, und sich dann mit tiefergehenden Informationen beschäftigen.“ Ein Wissen über solche Prozesse kann für Praktiker hilfreich sein.
Eine der Schlüsselkomponenten für überzeugende Kommunikation ist den Wissenschaftlern Petty und Cacioppo zufolge die positive Einordnung des Überbringers. So ist es kaum überraschend, dass eine Nachricht überzeugender ist, wenn ein als glaubwürdig eingeschätzter Kommunikator sie überbringt. Ein Indiz für Glaubwürdigkeit ist eine hohe Sachkenntnis, daher kann es auch in der Unternehmenskommunikation sinnvoll sein, unabhängige Experten sprechen zu lassen. Zudem lassen wir uns dem Psychologen Adam Cash zufolge eher von Menschen überzeugen die a) attraktiv und b) uns möglichst ähnlich sind.
Eine zweite für die PR relevante Theorie ist die der Kognitiven Dissonanz von Leon Festinger. Deren Kern: Hat ein Mensch mehrere Wahrnehmungen, Gedanken oder Einstellungen, die miteinander nicht in Einklang stehen, empfindet er dies als unangenehm. So treten kognitive Dissonanzen auf, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, obwohl es verlockende Alternativen gab, oder man sich entgegen seiner Überzeugungen verhält, ohne dies rechtfertigen zu können. Ein solcher Missklang kann sich zum Beispiel nach dem Kauf eines Produkts einstellen, in Form der „Post Decisional Regrets“, also des anschließenden Bereuens. Der Käufer sehnt sich nach Gründen, die belegen, dass er richtig gewählt hat. Um ihm dies zu bestätigen, ist es hilfreich, auch nach dessen Kaufentscheidung an seiner Seite zu bleiben. „Entscheidet man sich bei Fielmann für eine Brille und bekommt einige Tage später per Post die Nachricht, man könne diese auch noch umtauschen, solle sie nicht gefallen, wird das die inneren Misstöne beruhigen und das Image des Händlers verbessern“, nennt Psychologin Susanne Femers als Beispiel.
Ebenfalls auf mögliche Dissonanzen im Kopf baut die Foot-in-the-door-Technik von J. L. Freedman und S. C. Fraser. Diese besagt: Wer sich zu einem kleinen Schritt bereit erklärt, wie beispielsweise sich eine Aids-Schleife anzuheften, wird eher dazu neigen, sich diesem Thema in einem zweiten und bedeutend größeren Schritt selbst zu verpflichten und zum Beispiel für entsprechende Stiftungen zu spenden. Der Fuß in der Tür ebnet den Weg für folgende Kommunikationsmaßnahmen.
Weitere Theorien, die für die PR relevant sind, ist unsere Neigung zu Sozialen Vergleichen (Promi X hat dank Diätpille Y sein Gewicht reduziert, Sie schaffen das auch!) oder auch die psychologische Reaktanz. Diese beschreibt eine Motivation, sich von äußeren Einflüssen zu befreien. In einer Art Bumerangeffekt, reagieren wir mit Abwehr auf Kommunikation, die uns einseitig erscheint oder bei der die versuchte Beeinflussung allzu offensichtlich auf der Hand liegt. So entsteht Misstrauen und das Bedürfnis, die eigene Freiheit wiederherzustellen. Dieser Effekt ist laut Susanne Femers für die PR-Beratung quasi der „Größte anzunehmende Unfall“.
Illustration: Mona Karimi
Das Rollenbild klären
Mithilfe eines psychologischen Grundwissens lassen sich nicht nur Kommunikation und Überzeugungskraft stärken. Auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als einem Bündel von Erwartungen ist Teil der Sozialpsychologie. Insbesondere in der Rolle des Beraters ist es wichtig, sich abgrenzen zu können, ein Standing zu haben. Nur wer sich sein Rollenbild vor Augen führt und Konfliktdynamiken begreift, kann sich behaupten, moralisch Bedenkliches ablehnen und die eigenen Wirkungshebel erkennen.
Doch nicht nur externe Berater sind mitunter von Rollenkonflikten betroffen, auch Unternehmenskommunikatoren. Edith Wienand sprach bereits 2003 in ihrer kritischen Analyse „Public Relations als Beruf“ von einer „Abgrenzungsproblematik“ des Berufsfelds, für die eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsbezeichnungen symptomatisch sei. Heute, zwölf Jahre später, haben sich nicht nur die Positionsbegriffe auf den Visitenkarten, sondern auch die Anforderungen, vor allem im Bereich von Digitalisierung und Social Media, noch einmal vervielfacht. Die Rolle von Kommunikationsmanagern, PR-Beratern, Pressesprechern und Co. bleibt diffus. Zudem klaffen damals wie heute das Selbstbild der Kommunikatoren und ein oft von Vorurteilen geprägtes Fremdbild über den Beruf auseinander.
Psychologin und Kommunikations-Professorin Susanne Femers, bezeugt, dass die Position als Kommunikator im Unternehmen leicht mit einem Loyalitätsproblem einhergeht. Grund dafür sei die Sandwich-Position: Der PRler hat die Aufgabe, die Wahrnehmung des Unternehmens in der Außenwelt, bei Kunden und Kooperationspartnern, aufzuschnappen und bekommt intern die Bedürfnisse und Ärgernisse von Mitarbeitern mit. Mit diesen Eindrücken muss er eine Geschäftsführung konfrontieren, die oft ein Selbstbild hat, das davon abweicht. Der Kommunikator soll also darauf einwirken, Selbst- und Fremdwahrnehmung in Einklang zu bringen.
Oberstes sozialpsychologisches Gebot ist an dieser Stelle die Identifikation mit Tätigkeit und Arbeitgeber. Wer permanent öffentlich eine Meinung vertreten muss, die nicht seine ist, wird dies niemals überzeugend tun können. „Wenn ich Unternehmen oder Produkt nicht mag, kann ich nicht gut dafür kommunizieren. Ich sollte es allerdings auch nicht zu sehr lieben, sonst werde ich betriebsblind und bin nicht offen für Kritik“, erklärt Femers.
Zahlreiche Berufsfeldstudien offenbaren, wie vielfältig Kommunikatoren ihre Rolle interpretieren. Doch ob man sich als Techniker oder Sprachrohr versteht oder aber als Berater und eigene Marke, hängt maßgeblich von der Unternehmenskultur ab. Daher ist vor dem Antritt einer Stelle nicht nur zu prüfen, ob man sich mit dem Unternehmen identifizieren kann, sondern ebenfalls ob das angebotene Rollenbild dem Selbstverständnis entspricht. Grundsätzlich gilt: Je größer die Wertschätzung von Kommunikation, desto anerkannter auch die Rolle und die individuelle Ausgestaltung durch den Kommunikator.
Illustration: Mona Karimi
Die Gräben überwinden
Aber wie viel Psychologiewissen gehört nun in die Sprecherrolle? Die Kommunikationswissenschaft bedient sich unterschiedlichster Disziplinen und geht dabei wenig systematisch vor. Zu wenige Kommunikatoren erkennen, wie nützlich eine sozialwissenschaftliche Qualifikation für sie sein könnte. Um Stakeholder besser zu verstehen und auf sie eingehen zu können, aber auch, um die eigene Rolle näher zu beleuchten und sich ihr bewusst zu werden. Doch nicht nur von Seiten der PR besteht eine gewisse Grundskepsis gegenüber der Sozialwissenschaft, auch von der anderen Warte aus gibt es Vorbehalte, wie Susanne Femers seit Jahren beobachtet. „Als ernsthafte psychologische Wissenschaftler möchten sich die meisten mit PR nicht die Hände schmutzig machen, indem sie Manipulationswissen verbreiten“, beschreibt sie das vorherrschende Bild. So seien es die BWLer gewesen, die das Involvement, also die Einbindung des Konsumenten, ins Marketing eingebracht hätten, nicht die Psychologen. Und die zahlreichen neuen Studiengänge mit dem Fokus auf Wirtschaftspsychologie? Auch hier findet man kaum den Bezug zur PR. Dabei wäre es dringend an der Zeit, die Gräben zu überwinden und endlich beieinander einen Fuß in die Tür zu bekommen.
„In beinahe jeder Handlung unseres Lebens werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen“, lautet ein Zitat von Edward Louis Bernays, dessen Lucky-Strike-Kampagne angesichts steigender Umsätze ein voller Erfolg wurde. Doch während das Mintgrün in den Kleiderschränken langsam in Vergessenheit geriet, wandte sich der PR-Mann von der Tabakindustrie ab und arbeitete in den 1960er Jahren sogar für eine Anti-Rauch-Kampagne. Ein klarer Fall von Kognitiver Dissonanz, würde man heute sagen. Doch die negative Außenwirkung einer so uneinheitlichen Linie war ihm offenbar nicht klar. Ärgerlich für Bernays; wenn er das mal vorher gewusst hätte. _
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Psychologie. Der Kommunikator und seine Rolle. Das Heft können Sie hier bestellen.