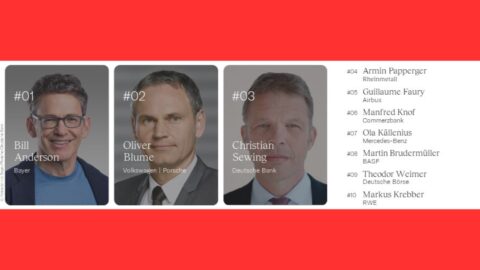pressesprecher: Herr Schmid, hört man das Wort ‚Regisseur’, denkt man: ‚Klasse, Schauspieler herumkommandieren.’ Wie kommt man auf diesen Beruf?
Das kam bei mir über Umwege zustande. Ich habe an der Filmhochschule München Dokumentarfilm studiert. Auch dort führt man zwar Regie, nur nicht mit Schauspielern. Im Laufe des Studiums habe ich festgestellt, dass manche Stoffe fiktional besser zu erzählen sind. Daher begann ich, mich mehr und mehr für den Spielfilm zu interessieren, allerdings nicht mit dem Wunsch, Schauspieler herumzukommandieren. Mir ging es einfach darum, mit Spielfilmen Geschichten zu erzählen, die sich dem Zugriff eines Dokumentarfilmers entziehen.
Ein Regisseur leitet nicht nur die Dreharbeiten, sondern muss auch vorbereiten. Was muss ein Regisseur alles beachten, bevor es ans Set geht?
Wenn Dreharbeiten beginnen, heißt es oft ‚toi, toi, toi‘ oder ‚jetzt gilt es‘. Genau genommen sind für mich aber am ersten Drehtag die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen. Die Vorbereitung ist essenziell. Dazu zählen für mich in erster Linie zwei Dinge: das Buch und die Besetzung. Wenn wir das Buch einmal ausklammern, ist die Besetzung der erste Teil der Regiearbeit. Man versucht, Schauspieler zu finden, die für die Rolle möglichst genau passen. Andererseits denkt man aber auch über das Zusammenspiel dieser Schauspieler nach. Im aktuellen Film ‚Was bleibt‘ beispielsweise sollen die Schauspieler eine Familie darstellen. Wenn ich erst am ersten Drehtag feststelle, dass diese Konstellation nicht passt, ist es natürlich zu spät. In das Casting muss man daher eine enorme Sorgfalt legen.
Wie strategisch gehen Sie vor, wenn Sie Schauspieler und Drehorte auswählen oder erste Szenenbilder entwerfen?
Die Drehorte sucht man zusammen mit dem Szenebildner. Ihm erkläre ich, was ich genau suche. Viele Dinge gehen einfach ihren Gang, sobald klar ist, dass das Budget vorhanden ist, um den Film überhaupt produzieren zu können. Man bespricht das Buch mit allen Beteiligten, dem Kameramann, dem Szenenbildner, dem Tontechniker. Bei der Besetzung ist das von Fall zu Fall unterschiedlich. Zum einen gibt es die Situation, dass ich eine Rolle für jemanden schreibe. In einem Episodenfilm wie ‚Lichter‘ war für mich klar, dass ich eine Rolle für August Diehl und eine Rolle für Zbigniew Zamachowski schreiben möchte. Dann passt man die Figur entsprechend auf den Schauspieler an. Es gibt allerdings auch die Situation – ebenfalls bei ‚Lichter‘ – in der wir es nicht geschafft haben, die Besetzung bis zum Drehbeginn abzuschließen. Auch nach ein, zwei Wochen mussten wir also die Drehpausen nutzen, um noch einmal mit der Casting-Agentin letzte Rollen zu besetzen. Ich will mich in der Besetzung nicht von großen Namen oder dem Rat beteiligter Fernsehsender leiten lassen. Diese wollen oft, dass man prominente Schauspieler engagiert. Ich versuche mich, von all dem freizumachen und die Schauspieler zu finden, von denen ich überzeugt bin.
Und dann gelingt der Film genau so, wie Sie ihn sich zu Beginn der Dreharbeiten vorgestellt haben?
Das schaffe ich nie. Es gibt so viele Entscheidungen zwischen der Filmidee und der finalen Schnittfassung, dass man vielleicht 70 bis 80 Prozent von dem verwirklicht, was man sich vorgenommen hat. Viele Faktoren lassen sich nicht kontrollieren. Eine Szene ist für einen sonnigen Nachmittag geschrieben. Man ist aber an einen Drehplan gebunden, befindet sich am Set und es regnet. Man muss reagieren. Dadurch wird die Szene nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Gleichzeitig ändert sich aber auch meine Vorstellung vom fertigen Film permanent. Mit Besetzung der Rolle wird die Figur im Buch ein Stück weit zu dieser Rolle, so dass ich mir irgendwann nicht mehr vorstellen kann, wie die Figur anders aussehen könnte als mit dieser Besetzung. Manchmal bekommt man eine Facette hinzu, die ein Schauspieler der Rolle verleiht, manchmal verliert man aber auch etwas, weil es sich nicht umsetzen lässt.
Sie arbeiten viel mit Nachwuchsschauspielern, aber auch mit bekannten Stars zusammen. Mit wem sitzt die Szene schneller im Kasten?
Die Sorge, dass jemand der neu am Set ist, möglicherweise nicht professionell genug ist und die Abläufe verkompliziert, ist meistens unbegründet. Mit Schauspielern, die ihre erste große Filmrolle hatten, wie August Diehl oder Sandra Hüller, habe ich hervorragende Erfahrungen gemacht. Sie sind konzentriert bei der Arbeit. Auf der anderen Seite machen routinierte Schauspieler selten Anfängerfehler. Sie achten etwa eher auf den Ablauf von Bewegungen und Dialog. Aber manchmal ist für sie eine Rolle einfach nur ein Job. Dann kostet es mitunter Zeit und Überredungskunst, jemanden entsprechend zu motivieren. Aber das kommt nur selten vor.
Als Regisseur haben Sie die Schauspieler und Techniker vor sich, die Geldgeber im Nacken. Das heißt, Sie arbeiten viel unter Zeitdruck.
Das ist in der Tat sehr unangenehm. Jeder Drehtag verschlingt Geld. Ich versuche diesen Druck jedoch ein wenig abzufedern und ihn mir vor meinem Team nicht anmerken zu lassen. Das gelingt nicht immer. Dann merke ich, dass ich ungeduldig werde. Hin und wieder mache ich auch meinem Unmut Luft. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite – das waren in den Schlüsselpositionen in den vergangenen zehn Jahren dieselben – kennen mich inzwischen und verstehen, damit umzugehen.
Und die Schauspieler …
… versuche ich das gar nicht merken zu lassen. Das ist ein in sich geschützter Bereich. Wir versuchen bereits Wochen vor Drehbeginn zu proben, um so den Druck von den Drehtagen zu nehmen. So lassen sich schon vorweg bestimmte Haltungen und Manierismen der Figuren festlegen.
Sie haben mit verschiedenen Charakteren zu tun. Gibt es dann im Vorfeld auch Absprachen am Set über den persönlichen Umgang miteinander?
Nein. Ich möchte einen möglichst großen Teil des Tags für die Arbeit mit den Schauspielern freihalten. Mein Filmteam weiß das. Wir drehen mit sehr geringem Aufwand, eigentlich fast schon dokumentarisch. Wir folgen also den Schauspielern und ermutigen sie, auch einmal zu improvisieren oder Bewegungen zu ändern. Das steht für mich im Mittelpunkt. Die Arbeit des Aufnahmeteams wird darauf ausgerichtet.
Was heißt für Sie dann der Begriff ‚Führung’?
Ich versuche möglichst ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf eine andere Weise mit Schauspielern zusammenzuarbeiten, die mitunter ihr Innerstes nach außen kehren müssen. Gleichzeitig versuche ich die Dinge, die mir an einem Drehtag wichtig sind, durchzusetzen. Das heißt, ich muss Prioritäten setzen. Ich muss auch auf die Stimmung am Drehort und beim Team achten. Kann ich einfach mal die Mittagspause verschieben, weil jetzt noch eine Szene zu Ende gedreht werden sollte? Oder kann ich dem Team auch einmal zumuten, länger zu arbeiten, als es eigentlich üblich ist? Ich bin jemand, der durch Äußerungen und Anweisungen den Impuls und die Stimmung im Team vorgibt. Gleichzeitig gibt es aber auch aber auch den Regieassistenten, der die Stimmungen nach außen trägt.
Regisseure sollen ja mitunter recht eigenwillige Führungsstile entwickeln. Von Martin Scorsese etwa ist bekannt, dass er zu Wutausbrüchen neigt oder in einen Kasernenhofton verfällt. Andere wiederum lassen die Arbeit am Set locker angehen. Wo sehen Sie sich?
Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Bei uns geht es keinesfalls locker zu. Wir arbeiten sehr konzentriert, und wenn jemand stört oder nicht bei der Sache ist, bekommt er das auch zu spüren. Ich weiß, dass die Arbeit im Filmteam unausweichlich zu Konflikten führt. Ich weiche diesen Konflikten nicht aus, sondern versuche sie möglichst ruhig zu lösen. Aber sich gegenseitig anzubrüllen, käme nicht in Frage.
Wie reagieren Sie auf Starallüren bei Schauspielern?
Das habe ich bisher nur in sehr beschränktem Ausmaß kennengelernt. Wenn ich das Gefühl habe, dass ein Schauspieler nicht der Sache dient, aus der Reihe tanzt und glaubt, Anspruch auf eine Sonderbehandlung zu haben, gehe ich auf ihn zu und mache ihm klar, dass hier jeder gleich behandelt wird. Das verstehen auch die meisten. Ich hatte bei meinem ersten Film ‚Himmel und Hölle‘ gleich mit zwei sehr bekannten Schauspielerinnen zu tun und zwar Katja Riemann und Hannelore Hoger. Als junger, unerfahrener Filmhochschüler hatte ich fast Angst vor ihnen. Ich habe mich am Anfang regelrecht hinter dem Kameramann versteckt und mit ihm die Lichtführung diskutiert. Dann stellte sich aber heraus, dass das völlig unnötig ist, sondern beide sich jemanden wünschen, der die Szene genau beobachtet und ihnen auch Feedback gibt. Von Starallüren war dort nichts zu spüren.
Wenn Sie sich und Ihre Kollegen mit älteren Regisseuren vergleichen, denken Sie, es gibt einen neuen Führungsstil?
Nein, ich denke, das ist keine Frage des Zeitgeists, sondern von Individuum zu Individuum verschieden.
In Ihrem neuen Film ‚Was bleibt’, der im September in die Kinos kommt, geht es eher um unterschwellige Formen von Macht. Ein Familienidyll bekommt bei einem Besuch der erwachsenen Kinder deutliche Risse. Jetzt kommt die Frage, die Journalisten immer stellen: Warum dieser Stoff?
Bernd Lange, der Autor, und ich wollten eine Geschichte erzählen, die uns beide beschäftigt. Auch wenn es nicht die Geschichten unserer Familien sind, ist die Situation des Heimfahrwochenendes für uns ziemlich präsent. Die Hauptfigur Marko ist uns recht nahe. Es war in gewisser Weise ein Gegenentwurf zu unserem letzten Film ‚Sturm‘, der den Prozess mit einem serbischen Kriegsverbrecher behandelt – ein Zusammenhang, den wir in unserem Alltag nicht kennenlernen.
Der Film zeigt, wie sich traditionelle Familienmuster und Rollen auflösen, aber nur zum Schein. Der Familienvater Günter haut nicht auf den Tisch, entpuppt sich dennoch als Kontrollfreak. Er will verhindern, dass seine depressive Frau ihre Medikamente absetzt. Was hat es mit dieser unterschwelligen Autorität auf sich?
Günter ist in den liberalen Denkmustern der 1968er verhaftet. In der Familie hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten aber anders entwickelt. Er ist der Patriarch, der in der Außenwelt verwurzelt ist und die Familie ernährt hat.
In Ihren Filmen geht es häufig um Sprachlosigkeit und unterschwellige Signale. Tritt Autorität heute weniger offen auf?
Das lässt sich nicht verallgemeinern. In ‚Was bleibt‘ sind die beiden Söhne offenbar antiautoritär erzogen worden. Aber möglicherweise fehlt ihnen das Rebellierenmüssen gegen das Elternhaus. Einer scheint daran zu scheitern, der andere kommt damit nur scheinbar zurecht. Es fällt aber auf, dass sich unsere Generation, also die Mitte Dreißigjährigen, oft nicht gegen große Widerstände durchsetzen musste. Es gibt kaum einen Grund, gegen jemanden wie Günter zu rebellieren. Solche Eltern setzen kaum Grenzen.
In Ihrem Film ‚Requiem’, angelehnt an die Geschichte von Anneliese Michel, die infolge eines Exorzismus starb, zeigen Sie aber auch, wie Menschen an gesetzten Grenzen zerbrechen können …
Die Widerstände in ‚Requiem’ treten aber auch offensichtlicher zutage. Dort kann der Zuschauer eine andere Position einnehmen und hoffen, dass es der Protagonistin gelingt, sich von ihrem autoritären Elternhaus zu lösen. Das gelingt ihr jedoch nicht. In ‚Was bleibt‘ sind die Perspektiven etwas verschleiert.
In Ihren Filmen geht es häufig um menschliche und gesellschaftliche Abgründe. Man hat den Eindruck, dass man das Feuilleton damit schneller auf seine Seite ziehen kann als potenzielle Geldgeber. Wie viel Überzeugungsarbeit müssen Sie leisten?
Überzeugungsarbeit muss ich vor allem als Produzent leisten. Dass man das Massenpublikum nicht mit einem Kammerspiel bedient, ist mir klar. Aber es gibt auch ein Publikum, das genau diese Art von Film sehen will, denke ich. Aus dem Grund muss man bei den Gremien nicht betteln, wenn sie vom Drehbuch überzeugt sind. Es ist durchaus möglich, die Finanzierung für einen Film innerhalb von sechs Monaten auf die Beine zu stellen.
Der Film ist im Kasten, wird veröffentlicht. Dann kommen die Journalisten. Für Sie eine Möglichkeit, den Film zu erklären oder doch nur immer wieder die gleichen Fragen?
Ich finde es spannend, über den Film mit Journalisten oder dem Publikum in Kontakt zu treten. Auch wenn ich Manches nicht erklären kann oder erkären will, interessieren mich die unterschiedlichen Interpretationen. Ich mache schließlich Filme, um mich mit Anderen darüber auszutauschen. Spielfilme haben ein ganz anderes Eigenleben als Fernsehfilme. Ich begleite meine Filme auf einer Kinotour, spreche dort mit dem Publikum und bekomme hautnah mit, wie sie auf diese Arbeit reagieren.
Als Regisseur müssen Sie sich auch mit Kritik auseinandersetzen. Ein Beispiel zu Ihrem aktuellen Film. Tobias Kniebe schrieb über Ihren Film: „Es hat aber auch keinen Sinn, auf ewig in Berlin-Mitte oder in München-Schwabing herumzuhängen und immer nur den halben Weg zu gehen.“ Mit anderen Worten, die Piefigkeit der Kleinfamilie wurde begriffen, wann geht es mal um die wirklich wichtigen Themen? Wie gehen Sie mit solcher Kritik um?
Ich schätze Tobias sehr, aber genau diesen Satz habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was er dem Film damit vorwirft. In diesem Sinne: Ich gehe eigentlich gar nicht damit um. Ich lese es und nehme es zur Kenntnis.
Wie motivieren Sie eigentlich Ihr Team zum Weitermachen, wenn eine Szene schon 20, 30 Mal gedreht wurde, aber einfach nicht im Kasten landet?
Zunächst einmal muss man sich selbst motivieren, dem Gefühl nachgeben, dass das, was man hat, noch nicht gut genug ist. 20 Wiederholungen kommen schnell zusammen, wenn jede Szene in etwa fünf Einstellungen hat. Wenn jede Einstellung viermal wiederholt wird – das ist noch an der Untergrenze – hat man einen Satz 20mal gesagt. Natürlich gibt es dabei Abnutzungserscheinungen. Entweder muss man dann noch mal eine Pause einlegen und über die Szene sprechen oder aber der Kameramann verlässt die vorgefertigte Einstellungsliste und überrascht die Schauspieler. Er schwenkt oder zoomt, ohne vorher Bescheid zu sagen. Das rüttelt viele Schauspieler noch einmal wach. Sie erkennen dann, dass sie eben nicht eine Viertelstunde im Off spielen müssen, sondern in jedem Augenblick in der Nahaufnahme zu sehen sein können. Manchmal versuche ich, die Spielweise eines Darstellers abzuändern, damit der angespielte Schauspieler merkt: ‚Hoppla, hier hat sich etwas verändert.‘ Die Situation wird für seine Figur vielleicht aggressiver oder angenehmer, und er muss darauf reagieren. In anderen Fällen verbinden wir einzelne Szenen zu einem langen Ablauf. Bei ‚Lichter’ oder ‚Requiem’ waren Blöcke bis zu fünf Minuten lang. Das wirkt fast wie ein kleines Theaterstück, in dem sich während der fünf Minuten ein kleiner Spannungsbogen entwickeln kann.
Mag Ihr Team Sie noch nach einem harten Drehtag?
Ich denke schon. Die Frage sollte eher lauten: ‚Mag ich mein Team noch nach einem harten Drehtag?‘ Aber im Ernst. Wir mögen uns auch noch nach einem anstrengenden Tag.
Interviewt wurde Hans-Christian Schmid. Er ist Regisseur und Inhaber der Berliner Produktionsfirma 23/5. Schmid studierte Dokumentarfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film München und absolvierte ein Drehbuchstudium an der University of Southern California. Bekannt wurde er unter anderem durch die Filme ‚23‘, ‚Crazy‘, ‚Sturm‘ und ‚Requiem‘.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Führung. Das Heft können Sie hier bestellen.