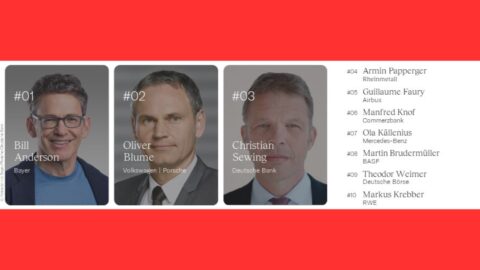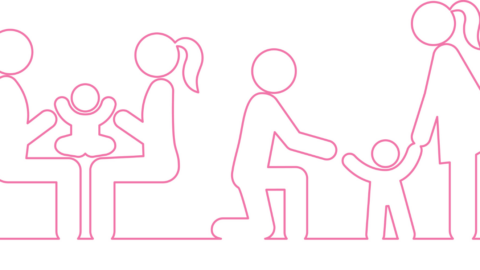Was hat Karaoke mit Mentoring zu tun? Auf den ersten Blick erschließt sich der Zusammenhang nicht. Eine schöne Anekdote von UIrich Kirsch erklärt, was es damit auf sich hat. „Als ich meine Mentee bei einem Kongress ausgelassen beim Karaoke-Singen sah, wusste ich, dass sie mich nicht mehr braucht“, freut sich Kirsch, Geschäftsführer Kommunikation und Presse beim Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen.
Mehrere Jahre lang hatte er die junge Frau, heute 32, betreut. Kennengelernt haben sich Mentor und Mentee, als sie bei seinem Arbeitgeber ein Praktikum absolvierte, während sie noch studierte. Sie wechselte dann für das Volontariat in einen Großkonzern. Heute ist sie dort Leiterin der Internen Kommunikation.
Kirsch sagt: „Im Mentoring-Prozess habe ich erlebt, wie aus einer sehr zurückhaltenden, wunderbar fleißigen und bestens schreibenden Person eine sehr selbstbewusste und souveräne junge Frau geworden ist.“ Das Karaoke- Singen bezeichnet Kirsch im Rückblick als einen „Glücksmoment nach einer Bombenentwicklung in sechs Jahren. Das sind Erlebnisse, die man immer wieder hat“, resümiert Kirsch, der seit vielen Jahren Mentees betreut.
Im Bundesverband deutscher Pressesprecher (BdP) ist der 61-Jährige als Bildungsbeauftragter für die sogenannten „Young Professionals“ und für die Förderung des Nachwuchses zuständig. In seinen 32 Berufsjahren hat er rund 500 Praktikanten betreut und drei Volontäre in Referenten-Positionen geführt. Kirsch kann Mentoring- Programmen nur Vorteile abgewinnen: „Mentoring ist eine sehr gute Sache, weil der oder die Mentee auf einer persönlichen Ebene einen Sparringspartner bekommt, der mehr Erfahrung hat.“
Wie sieht er seine Rolle als Mentor? „Man steht an Weggabelungen als Berater zur Verfügung. Ich bin aber nicht der Oberschlaumeier“, räumt er ein. „Man wägt gemeinsam Vor- und Nachteile ab, denn der erfahrene Mentor weiß, wie Karrieren in der PR- und Kommunikationsbranche ablaufen, und kann neue Blickwinkel eröffnen.“ Als formalisierte Beziehung hat er es nie begriffen, er betrachtet Mentoring als Persönlichkeitsbildung. „Sonst brauche ich keinen persönlichen Mentor“.
Der Mentor – Praktiker mit Wissen und Berufserfahrung
Generell lässt sich zwischen informellen und formalisierten Mentoring-Modellen unterscheiden. Bei dem ersten Konzept hängt das Gelingen in erster Linie von der Motivation der Tandempartner ab. Bei der zweiten Variante gibt es mehr Kontrolle, etwa mit einem fixierten Ablaufprogramm über einen definierten Zeitraum, klar formulierten Zielen, einem Briefing der Mentoren, einem umfangreichen Auswahlprozess der Mentees, einer Start- und Abschlussveranstaltung, einem Begleitprogramm, in dem sich die Mentees regelmäßig austauschen können, und einer abschließenden Evaluation. Ein solches Projekt ist arbeitsintensiv – darüber muss sich jedes Unternehmen und jeder Verband, der es implementieren will, im Vorfeld klar sein.
Welche Fähigkeiten muss ein Mentor mitbringen? Im Gegensatz zu einem Coach hat der Mentor keine spezifische Ausbildung für seine Aufgabe, sondern agiert als Praktiker, der sein Fachwissen und seine Berufserfahrung weitergibt. Gerade wenn es aber um Persönlichkeitsbildung geht, muss der Mentor auch über genügend Einfühlungs- und Reflexionsvermögen verfügen, um hilfreich zur Seite zu stehen.
Da die Programme wie etwa im BdP frei gestaltet werden können, hängt es vom Engagement des Mentors ab, wie viel Zeit er investiert. Der Mentor muss natürlich bereit sein, für den Mentee regelmäßig verfügbar zu sein, was angesichts von Zeit- und Termindruck in der Branche sicher nicht immer einfach ist.
Profitieren vom gewachsenen Netzwerk
Funktioniert hat es bei Jana Schöneborn und Uta Hellweg, Abteilungsleiterin Interne Kommunikation und Netzwerke bei der Konrad-Adenauer- Stiftung. „Ich hatte immer den Eindruck, dass sich Frau Hellweg sehr viel Mühe trotz ihres sehr vollen Terminkalenders gibt, und ich musste nie lange warten. Wir haben das Mentoring beide als Freizeit betrachtet. Das ging eigentlich immer ohne Zeitdruck, wir saßen manchmal richtig lange zusammen“, erzählt Schöneborn.
Sie nahm von 2015 bis 2016 am Mentoring- Programm für Young Professionals vom BdP teil. Gleich ihr erstes Treffen mit Hellweg fühlte sich für sie an wie ein „Volltreffer. Wir haben uns supergut verstanden.“ Das Matching erfolgte über den Verband, aber alles danach war Mentor und Mentee überlassen. Die beiden Frauen sahen sich etwa einmal im Monat, sie verabredeten sich zum Mittagessen, trafen sich nach Feierabend, gingen spazieren oder unterhielten sich in Hellwegs Büro.
Schöneborn war zu dieser Zeit am Ende ihres Studiums an der Universität Kopenhagen und arbeitete bereits ein bis zwei Tage in der Woche für einen Windenergie- Verband im Bereich Public Affairs und Lobbying. Sie sagt: „Uta Hellweg hat mich mit anderen Leuten vernetzt, die mir helfen können.“ Im Vordergrund stand, die Branche kennenzulernen und dort Fuß zu fassen. „Wenn ich es darauf angelegt hätte, hätte ich über das Mentoring sicher meinen ersten Job gefunden“, sagt Jana Schöneborn.
Da Schöneborn dann von Berlin nach Frankfurt umzog, endeten die Treffen. Mittlerweile arbeitet sie in der IT-Beratung. Aufgrund dieser beruflichen Umorientierung ist der Kontakt zu ihrer ehemaligen Mentorin weniger geworden.
Stabilität und Sicherheit für Mentees
Uta Hellweg betreut im Moment eine neue Mentee beim Start-up „Mentor Me“. Das Programm, für das man insgesamt 250 Euro zahlt, richtet sich nur an Frauen. Hellweg hat bislang fünf Mentees über BdP und „Mentor Me“ betreut. Bei „Mentor Me“ wurden die Mentoren bei einer Einführungsveranstaltung einen Tag lang gebrieft. „Das fand ich sehr anregend“, sagt Hellweg im Rückblick.
„Karriereberaterin“ findet sie für ihre Rolle ein „schreckliches Wort“: „Der oder die Mentee bekommt in einer Phase, in der bei ihm oder ihr sehr viel im Umbruch ist, Stabilität und Sicherheit im Veränderungsprozess.“ Jede ihrer Mentees kam mit einem individuellen Anliegen. Die erfahrene Kommunikatorin profitiert ebenso. Hellweg: „Ich lerne dabei von einer anderen Kommunikationsgeneration.“ Mentoren rät sie, ihre Netzwerke für die Mentees zu nutzen.
Nele Graf und Frank Edelkraut haben ein Buch zum Thema Mentoring in Unternehmen geschrieben. Graf ist Professorin an der Hochschule für angewandtes Management in Erding und Berlin und Geschäftsführerin der Mentus GmbH. Was für sie einen guten Mentor ausmacht? „Zuhören und Fragen stellen“, sagt sie. „Der Mentor sollte sein Erfahrungswissen reflektiert weitergeben. Eine seiner Kernkompetenzen muss sein, dass er sich selbst kritisch hinterfragt. Ich halte sehr viel davon, Mentoren nicht ungeschult auf Mentees loszulassen. Sie müssen sich darüber klar werden, was ihre Rolle ist, was sie leisten können und was nicht. Eine Schulung von zwei bis drei Stunden reicht schon, um den Mentor auf das Programm einzustimmen.“
Ein Problem bei festen Mentoren- Programmen, die oft ein Jahr lang ein Treffen im Monat umfassen, sieht Graf darin, dass sie zu einer Art Ad-hoc-Kaffeetrinken verkommen, bei dem die Arbeit an einem konkreten Ziel in den Hintergrund gerät. Ihr Rat deshalb: Der Mentee muss die Treffen gut vor- und nachbereiten. Mentoren wiederum können mithilfe ihrer Netzwerke die richtigen Türen öffnen helfen.
Lerneffekte für den Mentor
Wie Uta Hellweg hat auch Philipp Schnorbus auf Vermittlung des BdP als Mentor eine junge Frau rund eineinhalb Jahre betreut. Schnorbus ist Global Internal Communications Manager bei BASF in Frankfurt. Seine Mentee, heute 27, studierte zu Beginn des Mentorings Kommunikationsforschung an der Universität Hohenheim, sie arbeitet mittlerweile im Bereich Integrität des Change Management bei Daimler.
Da beide nicht in derselben Stadt lebten, telefonierten sie häufig oder tauschten sich über E-Mails aus. Gelegentlich gab es auch Treffen. Schnorbus zeigte der Frau beispielsweise den BASF-Standort in Ludwigshafen oder sie trafen sich beim Jahresempfang des BdP.
Konkret sah das Mentoring unter anderem so aus, dass Schnorbus ihr Feedback zu ihrem Lebenslauf gab, sie bei der Abschlussarbeit mit Korrekturlesen unterstützte und beide über Karriereentwicklung und -planung sprachen. Aber auch er lernte dazu: „Es hat mir selbst einen neuen Horizont für aktuelle Trends in der Kommunikationsforschung eröffnet, denn die Studierenden sind da sehr nah dran.“
Schnorbus hält es für sinnvoll, wenn sich Mentor und Mentee für ähnliche Fachgebiete interessieren, also beispielsweise ein Mentor aus dem Agenturbereich einen Mentee betreut, der ebenfalls in diesem Bereich arbeiten will. Doch das Mentoring kann an Grenzen stoßen: „Es geht nicht darum, dem Mentee einen Job zu suchen – wohl aber darum, den Mentee beim Einstieg ins Berufsleben durch Ratschläge, Anregungen und Feedback zu unterstützen und zu begleiten.“
Seine Rolle definiert Schnorbus so: „Als Mentor sollte man offen sein, sich auf einen Austausch einlassen und auch das aufnehmen, was der Mentee mitbringt. Der Mentee ist der Themensetzer, das Agenda Setting ist seine Aufgabe. Der Mentee sollte eine steuernde Funktion übernehmen, sich also fragen: Was habe ich vor, was erwarte ich mir vom Mentoring?“
Schnorbus hat selbst nach wie vor einen Mentor, auch wenn er diesen nicht über ein offizielles Programm kennenlernte. Nach dem Studium der Politik, Kommunikationswissenschaft und des Zivilrechts in Münster wollte er Journalist werden. Dann entschied er sich für ein Praktikum bei einer BASF-Tochter in Münster. Da es ihm gefiel, absolvierte er dort ein Traineeship. „Zu meinem ersten Chef in der BASF habe ich heute noch regelmäßigen und engen Kontakt. Vor jedem meiner Berufswechsel tauschen wir uns aus. Seine Meinung“, sagt Schnorbus, „ist mir immer wichtig.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe PROTEST. Das Heft können Sie hier bestellen.