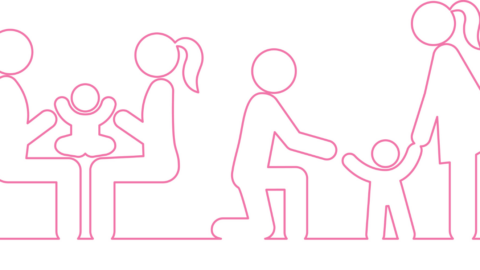Gebeutelt vom Dauerchange, überfrachtet mit einer Vielzahl neuer Aufgaben und das alles bei einem offensichtlichen Mangel an Strukturen: Auf Kommunikatoren stürmt zurzeit eine Menge herein. Die gute Nachricht: Zumindest teilweise haben seine Vertreter es selbst in der Hand, etwas daran zu ändern und die eigene Rolle (neu) zu definieren. Die schlechte Nachricht: Auch das kostet eine Menge Energie – und Geduld.
Beides aufzubringen fällt deshalb so schwer, weil schon die vergangenen Jahre einem Marathon glichen. Nach dem Trend, eine integrierte Kommunikationsabteilung zu schaffen, sollten plötzlich überall Newsrooms entstehen, Kanäle für Multichannel-Storytelling wurden aufgebaut und Labs eingerichtet. Vieles davon musste zusätzlich zu den Aufgaben in Pressearbeit, Reputationspflege, Controlling und Co. geleistet werden. Klingt nach einer Zeit, sich endlich auf den Lorbeeren auszuruhen – eigentlich. Ist es aber nicht.
Anja Schäfer*, die anonym bleiben möchte, spricht offen über das Phänomen, dass Ansprüche bei nahezu gleichbleibenden Ressourcen zunehmen. Das achtköpfige Kommunikationsteam eines Forschungsinstituts, dem sie angehört, musste in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben übernehmen. Ein Corporate Blog sollte her, verschiedene Social-Media-Kanäle wurden eingerichtet, Präsenzen in Berufsnetzwerken geschaffen. Zudem nahm die Themenvielfalt des wachsenden Instituts stetig zu. Neben der Veranstaltungsbetreuung und weiteren Pressearbeit hat das Team nun alle Hände voll zu tun, die diversen Kanäle zu bespielen.
„Teils gehen Entscheidungen zu Neuerungen in der Kommunikation mit der Strategie einher, teils werden sie isoliert gefällt“, sagt sie. Die zusätzlichen Kanäle hätten aus Schäfers Sicht angesichts der Überstundenkonten eigentlich die Einstellung von zwei bis drei weiteren Vollzeitkräften erfordert. Aber dafür würden keine Mittel bereitgestellt.
Neue Ära, neue Kämpfe
„Die Unternehmenskommunikation wurde jahrelang absorbiert von der Aufgabe, digitale Neuerungen zu installieren und zu etablieren“, sagt Nicole Rosenberger, Professorin für Organisationskommunikation und Management an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Um herauszufinden, wie Kommunikatoren ihre Rolle leben und welche Ansprüche sie an sich selbst stellen, wohin sich ihr Beruf entwickelt und welche die größten Wandlungsfelder sind, startete Rosenberger 2017 zusammen mit Markus Niederhäuser eine Studie im DACH-Raum. Um das Bild zu komplettieren, befragten sie in Experteninterviews nicht nur Kommunikationsverantwortliche, sondern auch Führungspersonal mit Außenblick auf Kommunikatoren, beispielsweise aus Vorständen und Marketing.
„Die Mehrheit der Kommunikatoren war schon bisher sehr stark mit der Digitalisierung der Kanäle gefordert“, sagt Rosenberger. „Nun kommt die Disruption in den Unternehmen hinzu: Im Zuge der Digitalisierung werden ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt. Ein Quantensprung.“ Was also nach der Digitalisierung der Kommunikation startet, ist die Kommunikation der Digitalisierung – und die laufe mit oder ohne die Kommunikatoren. „Sie sollten das Feld also nicht den anderen überlassen.“
So sieht es laut Studie auch das Führungspersonal in Unternehmen: Wenn sich die Unternehmenskommunikation nicht das Mandat nimmt, dieses Thema als aktiver Treiber voranzubringen, dann ist sie schnell passé. Stattdessen übernehmen IT und Marketing die Federführung. Rosenberger: „Alle Beteiligten sind sich einig, dass Kommunikatoren dringend gebraucht werden und selbstbewusst sein sollten. Dass CCOs die Kommunikation der Digitalisierung prägen und die Mitarbeiter, die durch Social Media selbst verstärkt zu Sendern werden, zur Kommunikation befähigen, ist erwünscht – und für das Unternehmen insgesamt von unschätzbarem Wert.“
Manager der Digitalisierung
In Zeiten des Changes gebe es naturgemäß Grabenkämpfe um Kompetenzen. Die eigene Rolle klar zu definieren und Themen zu beanspruchen, wird wichtiger denn je. Langsam setze das Bewusstsein ein, dass es nicht mehr nur um die Vielfalt der Kanäle geht, sondern auf in eine ganz neue Ära, glaubt Rosenberger.
Wenig zuträglich für das Selbstbewusstsein ist die herrschende Verunsicherung, die aus solchen Change-Situationen resultiert. Dabei sind viele aktuell gefragte Kompetenzen, wie vernetztes Arbeiten und die interne wie externe „Übersetzung“ und Moderation von Themen, seit jeher Kerngeschäft der Kommunikation. Darauf solle man sich besinnen, rät Rosenberger, anstatt sich selbst – gerade in puncto digitaler Transformation – mit überhöhten Ansprüchen zu überfordern. „Ich muss verstehen, was die neuen Technologien können, beispielsweise wie Algorithmen funktionieren, aber ich muss nicht selbst programmieren können.“
Auch Cornelia Müller, die bei der Aareal Bank Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die interne Kommunikation sowie Marketing verantwortet, glaubt nicht, dass der Job heute grundlegend andere Fähigkeiten erfordert als vor 15 Jahren. Zu den wichtigsten Kompetenzen gehöre heute wie damals die Fähigkeit, sich zu vernetzen, kollaborativ zu arbeiten und Menschen quer durchs Unternehmen zur Zusammenarbeit und Kommunikation zu befähigen.
„Zum ITler werden muss der Kommunikator nicht. Aber er sollte neue Techniken unbedingt verstehen lernen. Um Spezialisten zu führen, muss er wissen, wie die Dinge funktionieren und was alles möglich ist“, sagt sie. Natürlich brauche es ein Grundverständnis dafür, wie sich beispielsweise Datenspezialisten einsetzen ließen, operative Kompetenzen in diesem Bereich seien aber zu viel verlangt. Stattdessen kommt es auch darauf an, dass Schnittstellen zu anderen Experten – an denen Kommunikationsabteilungen schon immer eng anknüpfen mussten – neu definiert und gepflegt werden.
Generalisten sind nach wie vor gefragt
„Es ist ein sinnvolles Zukunftsszenario, angrenzende Bereiche immer weiter miteinander zu vereinen“, sagt Corinna Krause, Director Corporate Communications beim Berliner Technologieunternehmen First Sensor. Das bedeute, nicht nur enger zusammenzuarbeiten, sondern die Unternehmenskommunikation ganzheitlicher zu denken.
Krause verantwortet im Unternehmen neben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie interner Kommunikation auch die Investor Relations. Früher war diese Aufgabe an die Finanzbuchhaltung angegliedert, heute liefert diese die Zahlen an Krause und ihr Team. Eine folgerichtige Entscheidung, findet die Kommunikationschefin. Schließlich unterschieden sich Investoren in ihren Ansprüchen nach guter Kommunikation nicht von anderen Stakeholdern wie Mitarbeitern, Medien und Öffentlichkeit.
„Der Investor will die Zusammenhänge und Entwicklungen verstehen und keine reine Zahlensammlung präsentiert bekommen.“ Je mehr der Bereich in die Unternehmenskommunikation hineinwuchs, desto zufriedener zeigten sich die Aktionäre mit Kommunikation und Betreuung, berichtet Krause. Sukzessive landeten weitere Aufgaben auf ihrem Tisch, immer mehr Fragen vonseiten des Vorstands schlugen bei ihr auf. IR-Budget und Mitarbeiterin wurden schließlich bei ihr angedockt.
Im Unternehmen werde die Kommunikation als wichtiger Partner und Berater gesehen. Wie abhängig das Standing der Abteilung von der Person des Geschäftsführers ist, weiß Krause noch aus ihrer Zeit als Beraterin. Wenn an der Spitze die Bedeutung erkannt werde, ziehe sich dieses Bewusstsein durchs ganze Unternehmen. Die Realität jedoch sieht oft anders aus. Dass gerade die interne Kommunikation als nachrangig betrachtet werde, sei nach wie vor Alltag. Ebenso, dass das Marketingbudget größer sei als das der Kommunikationsabteilung.
Grabenkämpfe um Macht oder Budgets gebe es in ihrem Unternehmen zwar nicht. Aber die Bereiche könnten durch eine bessere Arbeitsteilung schneller funktionieren. Zu oft gebe es die Situation, dass sich Mitarbeiter aus beiden Teams parallel in ein komplexes Thema einarbeiteten. „Wir müssen uns koordinieren, denn gerade Schnelligkeit von Themen, gerade durch digitale Medien, das ist künftig die größte Herausforderung“, sagt Krause.
Reflexion versus Hamsterrad
Für ihre Studie wollten auch Nicole Rosenberger und Markus Niederhäuser wissen, was die größte Herausforderung sei, welche die digitale Transformation an Kommunikatoren stelle. Das Ergebnis überraschte: „An erster Stelle wurde keine technologische Komponente genannt, sondern die Frage: Wie befähige ich alle Mitarbeiter im Unternehmen zur Kommunikation?“
Trotz aller Kritik an den Umständen mag Anja Schäfer ihren vielseitigen Job im Institut, in dem sie Gestaltungsspielraum hat, ihre Ideen umzusetzen. Wäre da nicht die chronische Überlastung, das Gefühl in der Kommunikationsabteilung Getriebene der Entwicklung zu sein. „Am meisten wünsche ich mir Kapazitäten, um Prozesse strategisch aufzusetzen und dass die Kommunikationsleitung dieses Thema offensiver vorantreibt.“ Das Entwickeln von Konzepten und die Evaluation kämen zu kurz, das Abarbeiten im Hamsterrad überwiege. „In unserem Institut sind wir der Kropf, um es mal böse zu formulieren“, sagt Schäfer. Zu oft werde die Kommunikationsabteilung als Dienstleister gesehen, im Zweifelsfall habe sie sich zu beugen, bestehe zum Beispiel Uneinigkeit mit den Wissenschaftlern.
Eine Strategie auf drei Ebenen
Eigentlich hätten Kommunikatoren Lust, die neuen Herausforderungen anzugehen, so die Beobachtung der Schweizer Professorin Nicole Rosenberger. Das Problem sei, dass im hektischen Alltag Ruhe und Kapazitäten fehlten.
Doch wie lässt sich das Standing der Unternehmenskommunikation stärken, wenn dem CEO das Bewusstsein für dieses wichtige Thema fehlt? Rosenberger empfiehlt: Zunächst müssen auf der Mikroebene, das heißt innerhalb der Kommunikationsabteilung, digitale Kommunikation ermöglicht und die Mitarbeiter weiterentwickelt werden. Auf der Mesoebene gilt es, die Rolle der Corporate Communications innerhalb der Organisation festzulegen und deren Transformation nicht einfach zu begleiten, sondern mitzugestalten. Und schließlich wird auf der Makroebene definiert, welche Rolle sie im Austausch mit externen Stakeholdern wie Gesellschaft und Märkten einnehmen sollte, mit welchen Instrumenten sie beispielsweise Akzeptanz für neue Geschäftsmodelle schaffen kann.
„Kommunikatoren sollten sich für alle drei Ebenen Strategien zurechtlegen und jeweils prioritäre Ziele formulieren“, rät Rosenberger. Nur wer der eigenen Rolle auf diese Weise Bedeutung zuschreibe, sich der eigenen Ambitionen bewusst sei und diese immer wieder in Richtung Unternehmensführung kommuniziere, bekomme die Kompetenzen auch zugesprochen.
* Name von der Redaktion geändert
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe ALLES AUF ANFANG. Das Heft können Sie hier bestellen.