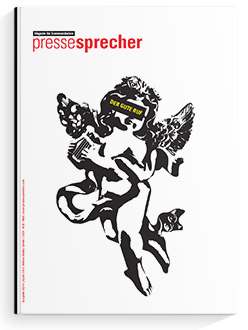Die Märzsonne taucht die Schillerpromenade in sanftes Licht. Es ist Montagvormittag und die von Altbauten gesäumte Straße menschenleer. Der Duft von Waffeln dringt aus einem kleinen Café am Neuköllner Herrfurthplatz. Ziemlich schön hier, friedlich. Der perfekte Startpunkt für Reinhold Steinles Führung durch seinen Berliner Lieblingskiez. Der in den 80er Jahren nach Berlin immigrierte Schwabe wurde einmal als „Botschafter Neuköllns“ bezeichnet. Den Titel trägt er mit Stolz. Steinles erklärtes Ziel ist es, das Image des vielleicht verrufensten Hauptstadtbezirks aufzubessern.
Als er 2008 mit den Führungen begann und dafür ein Gewerbe anmeldete, stellte die Dame im Amt Steinle zwei Fragen. Zuerst: „Was um Gottes Willen wollen Sie den Leuten in Neukölln zeigen?“ und – für ihn verunsichernder – „Wer soll da bitte kommen?“ Schließlich nahm Steinle es gelassen: „Der schlechte Ruf war für mich ein Ansporn. Ich wollte den Leuten beweisen, dass der Bezirk sehr wohl schöne Seiten hat.“ Und die möchte er heute präsentieren. In der einen Hand eine rote Gerbera, in der anderen eine Ledertasche voller Dokumente zur Stadtgeschichte, beginnt er seinen Rundgang.
Im Waffelkaffel: Nach zahlreichen Hindernissen ist Cafébesitzer Adrian Schefer (links) endlich im Schillerkiez angekommen (c) Laurin Schmid
Neue Kiezkultur
Nach zwanzig Metern schon der erste Zwischenstopp. „Guten Morgen, Herr Steinle, einen Kaffee für Sie?“, tönt es aus dem „Waffelkaffel“ entgegen allen Gesetzen der Berliner Freundlichkeit. Wir betreten ein gemütliches Café mit hellen Holzbänken. Während Adrian Schefer Bio-Schwarztee und Espresso zubereitet, erzählt er von seinen Neuköllner Anfängen. Vor zwei Jahren hat er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Paula den Laden eröffnet. „Inzwischen sind wir endlich wirklich angekommen.“ Kein leichter Weg. Denn in der Nachbarschaft war das Café zunächst wenig willkommen. Erst später erfuhren die Gründer, dass durch ihren Einzug im Haus die Mieten gestiegen waren. Besonders die älteren Bewohner machten ihrem Ärger Luft, einige spuckten sogar gegen die Fensterscheiben. „Vom Architekturstudenten, der nebenher ein Café betreibt, wurde ich plötzlich zum Politiker“, erinnert sich Schefer. Besser wurde es, als sie mit den Menschen im Kiez in den Dialog traten. Auch ein spezielles Nachbarschaftsangebot – Kaffee und Waffel für 2,50 Euro – stimmte versöhnlich.
„Der Schillerkiez hat sich stark verändert. Noch vor ein paar Jahren wäre ich hier abends nicht alleine langgegangen“, sagt Schefer. Diese Erfahrung teilt Reinhold Steinle für das benachbarte Rollbergviertel: „2008 wurde ich noch gefragt, ob ich bei meinen Führungen denn auch eine Knarre dabei hätte.“
Vielleicht ist es die Stimmung am Montagvormittag, vielleicht der Frühlingsanfang, der Harmlosigkeit und Ruhe ausstrahlt – heute wirkt die Gegend alles andere als bedrohlich. Wir setzen die Tour fort, vorbei an weiteren liebevoll gestalteten Restaurants und Cafés mit internationalen Besitzern. Gleich um die Ecke vom „Waffelkaffel“ befindet sich eine Berliner Oase: Das Tempelhofer Feld, ehemaliges Flughafengelände. Ein großer grüner Fleck inmitten des Stadtplans. Seit der Flughafenschließung im Jahr 2008 beheimatet es kleine Blumenbeete zum Selbstgärtnern, Spiel- und Picknickplätze und bietet vor allem viel Platz, sich inmitten der Großstadt sportlich auszutoben.
Handwerkskunst: Britt Sobotta hat viele Kunden in der direkten Nachbarschaft (c) Laurin Schmid
Ein Ruf und seine Geschichte
Nicht immer war die Atmosphäre hier so behaglich. Das weiß auch Steinle. Der schlechte Ruf der Gegend kommt aus einer Zeit, in der Neukölln noch Rixdorf hieß. Heruntergekommene Mietskasernen, kaum Unternehmerschaft, dafür aber umso mehr Kneipen prägten das Bild der zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch eigenständigen Stadt. „Wenn man sich um eine Lehrstelle bewarb und aus Rixdorf kam, war das schon ein Negativstempel“, sagt Steinle. Zum Feiern kam man allerdings von überall her, der Biergarten der Kindl-Brauerei allein fasste 10.000 Personen. „Viele Menschen, viel Alkohol – das führte natürlich immer wieder auch zu Prügeleien und Messerstechereien.“ Und dann war da noch dieser Gassenhauer „In Rixdorf ist Musike“ von 1889. Der hielt sich über Jahrzehnte in den Köpfen der Menschen und trug in der Interpretation von Heinrich Littke-Carlsen den Ruf Rixdorfs als frivole Vergnügungsgegend bis nach New York und Moskau.
Den Preußen war diese zweifelhafte Reputation ein Dorn im Auge. Zuerst ließ Kaiser Wilhelm II. den in Rixdorf beliebten Schiebertanz polizeilich verbieten. Wenig später beschloss er eine weitere PR-Maßnahme für ein besseres Image. An seinem 53. Geburtstag, dem 27. Januar 1912, genehmigte der letzte deutsche Kaiser die Umbenennung der Stadt von Rixdorf in Neukölln. Der neue Name war – gegen die Stimmen der Sozialdemokraten – in der Stadtratsversammlung durchgesetzt worden. Die ahnungslose Bevölkerung reagierte mit Spott und Häme. „Die meisten machten sich lustig über die Annahme, man könne mit einer Namensänderung den Ruf verändern“, so Steinle. In ganz Deutschland erschienen bissige Zeitungsartikel und Karikaturen. Auch nach der Eingliederung in die Berliner Stadtgemeinde 1920 blieb, Steinle zufolge, die miserable Reputation.
Wirklich gute Zeiten hat es für den Bezirk auch danach nicht gegeben: „Dichte Besiedelung, schlechte Wohnverhältnisse. Der Ruf Neuköllns war durchgehend negativ behaftet.“ Das wurde auch in überregionalen Medien in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder thematisiert. Im „Spiegel“-Artikel „Endstation Neukölln“ aus dem Jahr 1997 schreibt Peter Wensierski: „Neukölln ist Endstation. Die wenigen Studenten, die hier leben, verschweigen unter ihresgleichen solange es geht, dass sie in diesem Stadtbezirk wohnen, und wenn sie es zugeben, fügen sie rasch hinzu: ‚Aber ich zieh’ da bald weg!‘ Das Quartier hat keine attraktive Szene, kein nennenswertes alternatives Milieu, keine Subkultur.“ 17 Jahre später hat sich das Bild gewandelt. Auf Maklerseiten im Internet stößt man immer wieder auf Studenten, die explizit in Neukölln ein WG-Zimmer suchen, andere preisen ihre Wohnungen mit Verweis auf die hohe Kneipendichte und kulturelle Vielfalt im Bezirk an. Vor allem in Nordneukölln steigen die Mieten rapide.
Naherholung: Das Tempelhofer Feld bietet inmitten der Stadt viel freie Fläche (c) Julia Nimke
Alles wird schöner?
Gentrifizierung lautet das Stichwort. Reinhold Steinle zuckt dazu mit den Schultern. „Na ja, die Theorie geht doch so: Billige Mieten ziehen Künstler an. Künstler und Gewerbetreibende eröffnen Galerien und Läden. Das wiederum zieht junge Leute an, die für Kaufkraft sorgen. Cafés und Bars öffnen. Das weckt dann das Interesse von Investoren, die die günstigen Häuser kaufen und modernisieren.“ Und die Praxis? „Ich denke, es hat ganz viel mit Mode zu tun, vor allem bei jungen Leuten: Die Gegend ist wild, unverbraucht. Daher möchten sie hier leben.“
Die nächste Station von Steinles Tour ist ein Laden der besonderen Art. Zarte Stoffe, künstlerisches Ambiente. Die Berliner Miedermanufaktur auf der Schillerpromenade gibt es seit 2006. „Damit gehören wir hier fast schon zum alten Eisen“, sagt Britt Sobotta, studierte Malerin und gelernte Damenmaßschneiderin. Sie spielt damit auf den rasanten Wandel der Kiezkultur in den vergangenen Jahren an. Von Anfang an hat die Dresdenerin die Stimmung im Kiez geliebt. „Die urbane Atmosphäre ist gerade für Künstler sehr inspirierend“, schwärmt sie. Auch die bezahlbare Miete sprach für den Standort. Ihr hochwertiges Handwerk in Neukölln nicht verkaufen zu können, hat sie nie befürchtet. Tatsächlich wohnt ein großer Teil ihrer Kundschaft in näherer Umgebung. Aber es wagen sich auch von außerhalb Interessierte in den Laden. „Viele Westberliner, die zu mir kommen, sind erstaunt, wenn sie sehen, was aus dem Kiez geworden ist.“ Verwunderte Blicke, „dit is’ ja hübsch hier!“ Sobotta kennt die Reaktionen. Nur die Anfahrt mit den oft überfüllten und lauten Bahnen der Linie U8 bereite einigen Unwohlsein. „Aber das ist eben Großstadt hier.“
Ob Reuterkiez, Richardplatz oder vom Schillerkiez zum Rollbergviertel – Mehrmals im Monat bietet Reinhold Steinle seine Führungen durch das „andere Neukölln“ an. Termine und weitere Informationen gibt es unter www.reinhold-steinle.de (c) Laurin Schmid
Keine PR aus der Politik
Es hat sich sehr viel verändert in Neukölln. Dennoch kämpft Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky noch immer mit dem schlechten Ruf. Ob er ihn verbessern kann, ist fraglich. Steinle zweifelt. Das liegt auch daran, dass Buschkowsky vornehmlich Missstände in die Öffentlichkeit trägt. In Talkshows entsteht so ein einseitiges, negatives Bild: Kriminalität, Schulverweigerer, fehlgeschlagene Integration. Während der Bürgermeister auf Festen innerhalb des Bezirks die Stärken betont, erfährt man in den Medien wenig über Neuköllns Potenziale.
Auch Steinle berichtet einseitig – nämlich nur über die positiven Facetten des Bezirks. Dazu steht er. „Irgendjemand muss das ja machen.“ Bei den Leuten kommt es an, seine Touren sind beliebt. Nur Touristen kommen noch selten, „die finden mich nicht“. Es sind tatsächlich die Berliner, die sich die Geschichte ihres Bezirks in Steinles schwäbischem Singsang näherbringen lassen. Nach über hundert Jahren schlechter Reputation freut sich der Botschafter Neuköllns darüber, dass sich alte Vorurteile aufzuweichen beginnen. Nur: „Zu schick und teuer soll Neukölln bitte nicht werden!“ Spätestens wenn man den S-Bahn-Ring hinter sich lässt und den grauen Süden des Bezirks erkundet, scheint diese Befürchtung aber noch ziemlich unrealistisch.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Der gute Ruf. Das Heft können Sie hier bestellen.