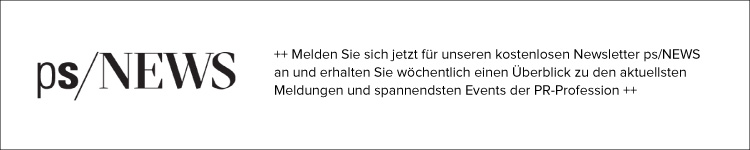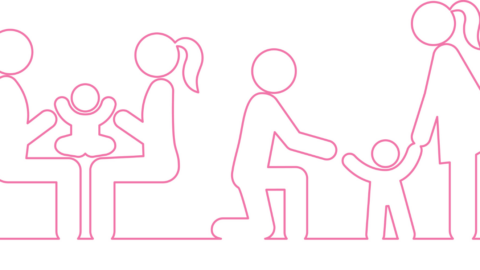Mit der Konkurrenz an sich ist das so eine Sache. Sie erlaubt kein Pauschalurteil. Weder ist sie per se gut noch schlecht. Man kann sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Tut man es, zeigt sie mal ihr motivierendes Gesicht, mal ihr hässliches, und manchmal möchte man sie einfach vergessen – oder zum Teufel wünschen. Konkurrenz kann anspornen, sie kann lähmen, sie nervt mitunter, sie kann das Beste aus einem herauskitzeln. Aber auch das Schlechteste.
– Anzeige –
Eine Kollegin etwa erzählte dieser Tage von Freunden, die einst Zahnmedizin und Jura studierten. Die einen hatten monatelang an Gipsmodellen von Gebissen gearbeitet, nur um eines Tages, kurz vor einer wichtigen Prüfung, festzustellen, dass die Modelle der drei Besten von Unbekannten entzweigebrochen worden waren. Die anderen stellten bei der Recherche in wichtigen juristischen Werken der hiesigen Bibliothek fest, dass entscheidende Zeilen geschwärzt worden waren. Ein Schelm, wer dabei Böses von den lieben Kommilitonen denkt. Konkurrenzdruck at its worst?
Eine Frage der Einstellung
Nicht wegzudiskutieren ist der Fakt, dass Konkurrenz unserer modernen Gesellschaft immanent ist. Thomas Kirchhoff vom Institut für interdisziplinäre Forschung in Heidelberg ist Herausgeber eines Bands, der sich mit historischen, strukturellen und normativen Perspektiven des Begriffs auseinandersetzt. Er nennt Konkurrenz ein „Epochenparadigma“.
Seitdem das Leistungsprinzip das Prinzip autoritativer Zuschreibung quasi abgelöst habe, um – zum Glück, muss man an dieser Stelle einfügen – eine liberalistisch-bürgerliche anstelle einer auf Privilegien beruhenden feudalen Gesellschaft zu realisieren, habe das Konkurrenzprinzip seit einigen Jahrzehnten „beinahe ubiquitäre Verbreitung gefunden“.
Der Beste werden. Der Beste sein. Der Beste bleiben. Das ist der Antrieb sowohl von großen Ökosystemen wie der Wirtschaft als auch von Biotopen wie dem Leistungssport, diesem idealisierten Abbild unserer auf Erfolg gepolten Gesellschaft. Im Sport wird Konkurrenz in besonderem Maße beobachtbar, ja bewunderbar. Wen packt das Finale eines olympischen 100-Meter-Laufs nicht, zumindest insgeheim? Acht Frauen oder Männer auf acht nebeneinanderliegenden, schnurgeraden Bahnen, eine Startlinie, ein Sprint von A nach B – simpler kann direkte Konkurrenz nicht erlebbar werden.
Wer sich am Ende durchsetzt im Wettbewerb, das wird durch eine Vielzahl Faktoren determiniert. Im Sport etwa entscheiden längst nicht bloß Muskeln, Ausdauer oder Trainingsstunden. Sondern vor allem die Einstellung. Wie hat der deutsche Diskus-Olympiasieger Robert Harting einmal so passend gesagt? „Sport ist 90 Prozent mental. Der Rest ist Kopfsache.“
Im Käfig des eigenen Ehrgeizes gefangen
Der Begriff „Konkurrenz“ stammt übrigens vom lateinischen concurrere. Das kann unter anderem „zusammenlaufen, zusammenströmen“ bedeuten, aber auch „zusammenstoßen, aneinandergeraten“. Wir lernen: Wie wir Konkurrenz definieren, ist stets eine Frage von Kontext und Perspektive.
Führungskräfte haben ihre eigene. Viele von ihnen verfahren nach dem Prinzip „Konkurrenz belebt das Geschäft“. Während sie die externe Konkurrenz in Form von Mitbewerbern allerdings nicht selten als lästig empfinden, wollen sie durch interne Konkurrenz zwischen Mitarbeitern die Leistung fördern. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch. Doch Wettbewerb hinterlässt naturgemäß Verlierer.
Und wenn die Mehrzahl zu Verlierern gehören muss, weil nur ein kleiner Teil der Konkurrierenden Sieger sein kann, liegen die potenziellen Nachteile auf der Hand: Resignation, Reibungsverluste, Intrigen, Fouls oder Missgunst, wie Winfried Berner in dem Ratgeber „Ermutigende Führung“ schreibt. Behutsame, wertschätzende Kommunikation kann hier entgegensteuern – bevor der Mensch im Käfig seines eigenen Ehrgeizes noch zum Raubtier (oder Aasfresser) wird.
Interessant ist, dass Verhaltensbiologen Neid für nichts grundsätzlich Schlechtes halten. Sondern für eine Art Controlling dafür, dass man an Einfluss gewinnt. Bedeutet: Neid muss man sich erarbeiten. Genau wie Lorbeer.
Wie wir mit Konkurrenten, Hierarchien, Wettbewerb und Drucksituationen umgehen, müssen wir am Ende jeder für uns selbst entscheiden. Der früheren indischen Premierministerin Indira Gandhi († 1984) wird in diesem Zusammenhang ein schönes Bonmot nachgesagt. Es lautet: „Mein Großvater sagte mir einst, dass es zwei Sorten von Menschen gebe. Die, die arbeiten. Und die, die sich die Lorbeeren für diese Arbeit einheimsen. Er sagte mir, ich solle versuchen, in der ersten Gruppe zu sein – es gebe dort viel weniger Konkurrenz.“
Dies ist das Titel-Essay der Ausgabe „Konkurrenz“ (5/18). Sie möchten das Magazin pressesprecher abonnieren oder kostenlos testen? Hier können Sie es bestellen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe KONKURRENZ. Das Heft können Sie hier bestellen.